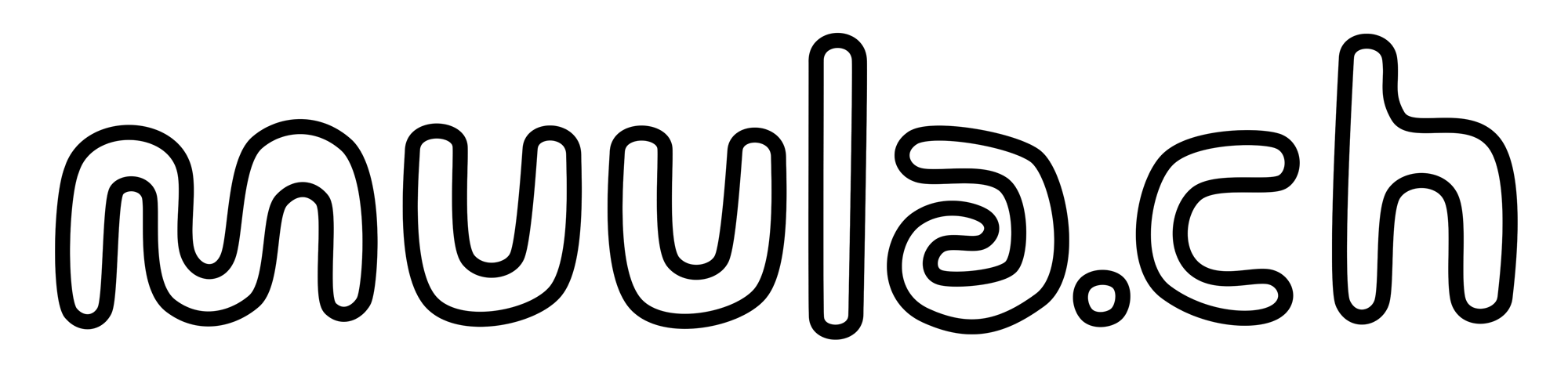Berücksichtigen Produkte auch Aspekte der Umwelt, wird häufig von wahren Kosten gesprochen. Das ist ziemlich unpassend.
Wer die «Neue Zürcher Zeitung» am heutigen Mittwoch aufschlägt, stolpert über einen Artikel mit dem Titel «Discounter verrechnet probeweise wahre Kosten».
Darin geht es darum, dass der deutsche Detailhändler Penny, der zur Rewe-Gruppe gehört, eine Woche lang für ein paar Produkte fast den doppelten Preis verlangt und damit die Kundschaft auch für die Kosten der Umwelt- sowie Gesundheitsschäden zur Kasse bitten will.
Preis für Pestizidbelastung
Klimaschädliche Emissionen oder Bodenbelastungen in der Landwirtschaft würden in den ursprünglichen Preisen der Produkte nicht berücksichtigt, so die Begründung. Daher bezieht der Discounter-Konkurrent von Aldi, Lidl & Co. einfach mal die «wahren Kosten» in die Verkaufspreise ein.
Doch halt – was sollen die Kosten für die Emission einer Tonne CO2 oder der Pestizidbelastung eines Stückes in der Landwirtschaft sein? Genau, da fängt das Problem an.
Beseitigungskosten als Krücke
Dem Hersteller entstehen durch die Nutzung der Ressource «Natur» oftmals keine Kosten, weshalb Umweltschützer für die negative Nutzung künstlich Kosten produzieren wollen. Aber was soll der Preis etwa für die Schadstoffbelastung eines Stückchen Ackerlandes sein?
Als Hilfsmittel nimmt die Wissenschaft dabei nicht selten die Kosten, die entstünden, um den Originalzustand wieder herzustellen.
Denkt man aber an radioaktive Belastung von Meerwasser oder das Gebiet um ein Atomkraftwerk, wird schnell klar, dass diese Vorgehensweise ihre Grenzen kennt.
Viele Möglichkeiten
Bei der Messung von Gesundheitsbelastungen von Pestiziden oder radioaktiven Strahlen in Flugzeugen wird das Ganze noch schwieriger.
Neben dem Ansatz der Wiederherstellungs-Methode gibt es aber noch eine ganze Reihe von anderen Methoden, um sich einem «wahren Preis» der Nutzung zu nähern.
Dabei sei exemplarisch auch auf Betrachtungen zu Opportunitätskosten verwiesen, welche die ökonomischen Werte von Umweltgütern darstellen sollen, indem sie auf den entgangenen Nutzen abstellen.
Bei radioaktiv verseuchtem Meerwasser wäre dies etwa das Badevergnügen in der betroffenen Region oder der verschwundene Fischbestand. Doch was soll das kosten?
Handel mit Zertifikaten an Börsen
Ein anderes Beispiel sind freiwillige oder obligatorische Klimaabgaben bei Airlines, über die muula.ch bereits berichtete, bei der mit den zusätzlich bezahlten Geldern für die Flugtickets aussichtsreiche Klimaprojekte unterstützt werden, die zur Linderung des Umwelt-Leidens vom Fliegen beitragen sollen. Ein Preis im Sinne eines Preise ist auch das jedoch nicht.
Bei der Vermeidung von CO2 versucht man aber auch, marktpreisbasierte Methoden anzuwenden, um etwa über das Handeln von Umweltgütern mittels Zertifikaten zu Preisen zu gelangen.
Funktionieren tut dies aber eher schlecht als recht.
Kein Patentrezept
All dies sind Krücken und zeigen, wie komplex die Materie mit Preisen von Umweltgütern ist. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile.
Discounter Penny stellt beim Verkauf der ausgewählten Produkte auf Wissenschafter ab, welche die Auswirkungen von Fruchtjoghurt, Käse, Würstchen oder eines veganen Schnitzels auf Boden, Klima, Wasser und Gesundheit analysierten und dadurch die Verkaufspreise der entsprechenden Güter um bis zu 94 Prozent steigen liessen.
Wahr oder unwahr ist daran nichts. Das sind einfach moralische Angebote.
Auf Alternativen ausweichen
Letztlich sorgen Preise dafür, dass Güter über Angebot und Nachfrage an jenen Stellen landen, wo sie den grösstmöglichen Nutzen stiften. Die Preise sollen signalisieren, wo die Knappheit am höchsten ist. Unternehmer nutzen aber ohnehin denjenigen Verkaufspreis, den die Kundschaft maximal für die Waren oder Dienstleistungen zu zahlen bereit ist.
Die Vorstellung, Firmen würden auf die Produktionskosten noch einen Gewinnaufschlag draufsatteln und dieses Konstrukt als Verkaufspreis verwenden, sind schon sehr antiquiert.
Viele, auf Freiwilligkeit basierte Aktionen mit Umweltabgaben funktionieren allerdings ohnehin nicht. Bei Penny werden viele Kunden sicher auch einfach auf alternativen Fruchtjoghurt, Käse oder Würstchen ausgewichen sein.
Win-Win für Firmen und Kunden
Umweltaspekte werden eben meist nur beachtet, wenn Menschen auch einen ökonomischen Nutzen davontragen.
Klassisches Beispiel dafür sind die herzzerreissenden Aufrufe von Hoteliers, die Handtücher im Bad oder die Bettwäsche im Zimmer doch einfach noch eine Nacht zu verwenden. Dies spart dem Unternehmer einerseits bares Geld für die Reinigung – es hat aber andererseits auch positive Effekte auf die Umwelt.
Intelligente Hoteldirektoren teilen daher die Kostenersparnis mit der Kundschaft und schaffen somit, neben moralischen Appellen, noch ökonomische Anreize, sich umweltbewusst zu verhalten.
Zahlungsbereitschaft ermitteln
Von wahren Kosten kann bei alldem dennoch nicht gesprochen werden. Die «NZZ» hätte das Wort «wahr» im Titel ihres Beitrages wahrscheinlich auch besser in Anführungszeichen geschrieben.
Und für Penny war die Aktion ein schöner Marketing-Gag, damit die Marke bekannter wird und das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund rückt.
Gleichzeitig kann der Discounter anhand der Verkaufsmengen sehen, wie hoch die Zahlungsbereitschaft der Kundschaft für die betroffenen Produkte zu diesem «wahren» Preisen tatsächlich ist.
02.08.2023/kut.