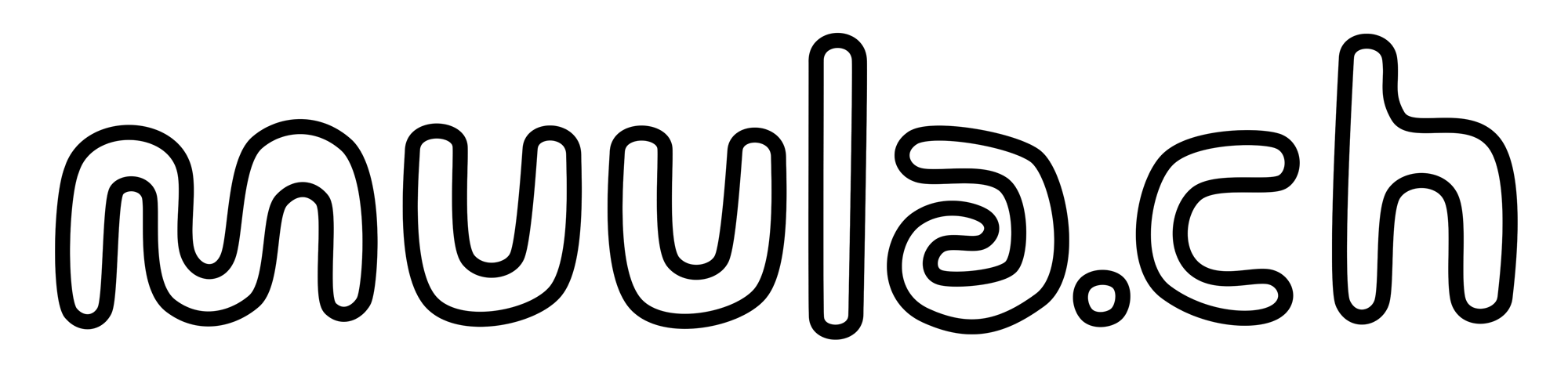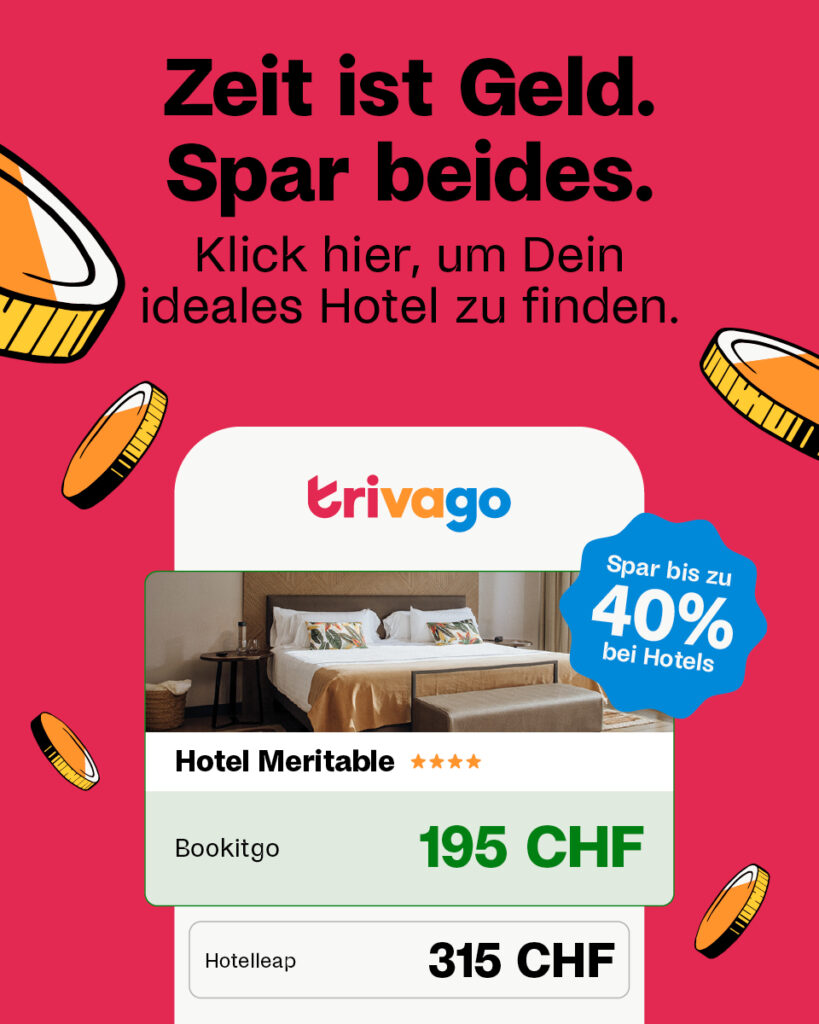Die Grossbank UBS gibt theatral das Ende der Krisenbank Credit Suisse bekannt. Dabei steht auch ihr Untergang oder Wegzug bevor.
Die Schweiz hat nur noch eine Grossbank, titeln am heutigen Montag viele Zeitungen.
Die UBS vollzieht laut einem Communiqué auf den heutigen Tag formal den staatlich erzwungenen Zusammenschluss mit der Krisenbank Credit Suisse (CS).
Wirkt wie Todesanzeige
In ganzseitigen Anzeigen in vielen Printzeitungen gibt die UBS das Closing der Transaktion mit den Worten bekannt, dass ein neues Kapital für die UBS, für den Finanzplatz Schweiz und für die globale Finanzindustrie anfange.
Die Printzeitungen dürften dabei nicht zufällig gewählt worden sein, denn sie sterben aus. Die Bekanntmachung der vollzogenen Fusion wirkt daher wohl zurecht wie eine Todesanzeige.
DIW warnt vor Super-Bank
Die Krisenbank CS ist Geschichte, doch am heutigen Montag dürfte auch das Ende der anderen Grossbank besiegelt sein.
Die Monsterbank, wie sie anfänglich von vielen Schweizer Medien noch bezeichnet wurde, ist viel zu gross für das Land.
Im Falle eines Falles kann die Schweiz dieses Geldhaus nicht mehr retten, wie etwa das bekannte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW gleich nach der historischen Bekanntgabe am 19. März erklärte.
Keine ausreichenden Massnahmen
Der Präsident des DIW sieht in der Rettungsaktion der CS nämlich ein grosses Risiko für die Schweiz.
«Die Übernahme von Credit Suisse durch UBS macht mir grosse Sorge, weil es eine derart grosse Super-Bank schafft, dass sie einen ganzen Staat in Schieflage bringen kann», sagte Marcel Fratzscher im Interview mit der Zeitung «Welt».
Strengere Eigenkapitalvorschriften, mehr Transparenz und eine einheitliche Aufsicht reichen laut Fratzscher nicht, um zumindest die Wahrscheinlichkeit künftiger Bank-Runs zu senken.
«Es geht darum, dass man ökonomisch kluge Anreize setzt, damit das Management einer Bank keine Risiken eingeht, die am Ende Steuerzahlergeld kosten können», sagte er. Das fange bei der Entlohnung an.
Liste mit Verboten
«Die Gehälter in der Bankenbranche sind jenseits von Gut und Böse. Wir sprechen von Angestellten, die in guten Zeiten hohe Boni kassieren, in schlechten Zeiten immer noch ein üppiges Festgehalt bekommen», betonte Fratzscher.
Wer hat diesbezügliche Limitierungen bei der Monsterbank UBS unter der Führung des alten, neuen CEO und Starbankers Sergio Ermotti bemerkt? Wohl niemand.
Die Party geht munter weiter. Es dürfte daher kaum Zufall sein, dass die ehrwürdige «Financial Times» am heutigen Montag ein Dokument zugespielt bekam, welche Geschäfte die UBS künftig den Bankern der einstigen CS erlauben will.
Es geht etwa um ein Verbot, neue Kunden aus Hochrisikoländern zu gewinnen und darum, von komplexen Finanzprodukten künftig Abstand zu nehmen.
Die Liste, die von der Compliance-Abteilung zusammengestellt wurde, betrifft finanzielle und nicht-finanzielle Risiken. Man will signalisieren, wir machen etwas.
Ein Satz bis zum Tod
Doch all dies wird der UBS nichts nützen. Die Risiken fallen den Geldinstituten meist Jahre später auf die Füsse, wenn alle Verantwortlichen schon über die Berge sind. Genauso wird der UBS der Blitz-Merger, den sie nun in Windeseile vollzogen hat, kaum helfen, um der Politik zuvorzukommen.
Es reicht im Prinzip ein Satz, das Leben der neuen Monsterbank auszulöschen.
Kreditinstitute in der Schweiz dürfen keine Bilanzsumme haben, die grösser ist als das Bruttoinlandprodukt BIP der Schweiz.
Immer wieder Notrecht
Beim Doppelten der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes wird es schon schwierig.
Egal, wie man es wendet, die UBS als fusioniertes Gebilde ist zu gross für das Land. Da spielt es auch keine Rolle, welche noch so kleinen Risiken damit eingegangen werden.
Im Zweifel muss die Schweiz diese Monsterbank retten können und dies kann das Land nicht, wenn es nicht glaubhaft einen Rettungsplan vorstellen kann.
Es müsste wahrscheinlich wieder Notrecht sein, doch diesmal mit viel geringeren Hilfsmitteln.
Volk sagt Nein
Mit nicht einmal 100 Milliarden Dollar an kombiniertem Eigenkapital und einer fusionierten Bilanzsumme von 1730 Milliarden Dollar, wie die UBS unlängst proforma der US-Börsenaufsicht SEC bekanntgab, ist sie international gesehen, jedoch noch ein kleiner Wicht. Aber für die Schweiz ist das Gebilde eben viel zu gross.
Nie wieder eine Grossbank retten, dies war der Tenor nach der jüngsten Finanzkrise als der Schweizer Staat die UBS mit zig Milliarden retten musste.
Nie wieder eine Grossbank retten, lautet der Tenor auch jetzt.
Die Schweizer Bevölkerung ist es leid, nochmals einspringen zu müssen.
Wegfall des Bankgeheimnisses
Das haben auch die Politiker verstanden. Sie wollen wieder die Hoheit über das Land haben und sich nicht mehr von der Finanzlobby auf der Nase herumtanzen lassen, sodass am Ende nur noch Notrecht hilft.
Die Linken werden alles tun, damit sich keine lasche Regulierung wieder im Land durchsetzt. Sie dürften das Volk auf ihrer Seite haben.
Die internationalen Rechtsklagen gegen die Schweiz werden den Menschen auch vor den Augen halten, dass solche Sachen dem Land teuer zu stehen kommen.
Mit dem Wegfall des Schweizer Bankkundengeheimnisses müssen die Geldhäuser hierzulande eben beweisen, dass sie besser sind als ihre Pendants im Ausland.
Die Rettungsaktionen zeigen, dass sie eigentlich nicht in der höchsten Liga der Banker-Gefühle mitspielen können.
Auch Finma und SNB betroffen
Somit ist der heutige Tag nicht nur denkwürdig, weil die einstige Escher-Bank nach fast zweihundert Jahren in die Geschichtsbücher eingeht und ein Konkurrent auf dem Finanzmarkt verschwunden ist.
Sondern es ist auch der Tag, der den Anfang vom Ende der neuen UBS markiert.
Doch der heutige Tag ist auch das Ende für zwei weitere Institutionen der Schweiz in ihrer heutigen Form. Es geht um die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma und die Schweizerische Notenbank SNB. Sie alle arbeiten bis in die Spitze mit Personal, das von den Grossbanken kommt.
Sie alle haben in der jüngsten Bankenkrise völlig versagt.
Die Finma soll aber gar keine scharfen Waffen am Finanzplatz haben. Der «Laissez faire» am Finanzplatz war doch bisher stets gewollt. Doch das ist nun vorbei.
Und auch die SNB kann so nicht weitermachen. Allen voran ihr Präsident Thomas Jordan hat in seinem Umfeld niemanden, der eine andere Sichtweise auf die Dinge gibt.
Keine Widerrede
Selbst der Vizepräsident Martin Schlegel ist ein SNB-Eigengewächs und ein treuerJordan-Anhänger.
Wie muula.ch unlängst aufdeckte, sassen Jordan und der letzte CS-Konzernchef Ulrich Körner sogar zusammen in der Expertenkommission, die nach der Fast-Pleite der UBS die ganze Regulierung neu aufsetzen sollte.
In extremen Stresssituationen sollte die Liquidität einer Grossbank künftig für mindestens einen Monat lang reichen, hatte Jordan versprochen.
Dies sollte selbst für den Fall eines Vertrauensverlustes einer systemrelevanten Bank gelten. Wie die CS zeigte, ging es nicht.
Merkwürdige Zahl
In der gestrigen «SonntagsZeitung» sagte Jordan, dass die Krisenbank in der Spitze rund 170 Milliarden Franken an Liquidität gebraucht habe.
Bei einer Bilanzsumme von rund 531 Milliarden Franken dürfte dies aber eigentlich gar kein Problem darstellen.
Also irgendetwas anderes ist da schiefgegangen.
Preisschild für Wegzug
Die Grossbank UBS jubelt um ihren Sieg am Schweizer Finanzplatz. Ein harter Konkurrent ist weg. Die UBS sollte aber eigentlich traurig sein, denn mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird es sie hierzulande auch bald nicht mehr geben.
Wenn ihr die Zerschlagung nicht gefällt, geht sie eben woanders hin.
Das Preisschild für den Wegzug hat das Eidgenössische Finanzdepartement EFD schon angehängt.
Die Garantie des Bundes von 9 Milliarden Franken wird nämlich nur gewährt, solange die UBS ihren Hauptsitz in der Schweiz behält.
Doch für internationale Player sind solche Summen ein Klacks. Nur für die Schweiz ist das eben viel Geld.
12.06.2023/kut.