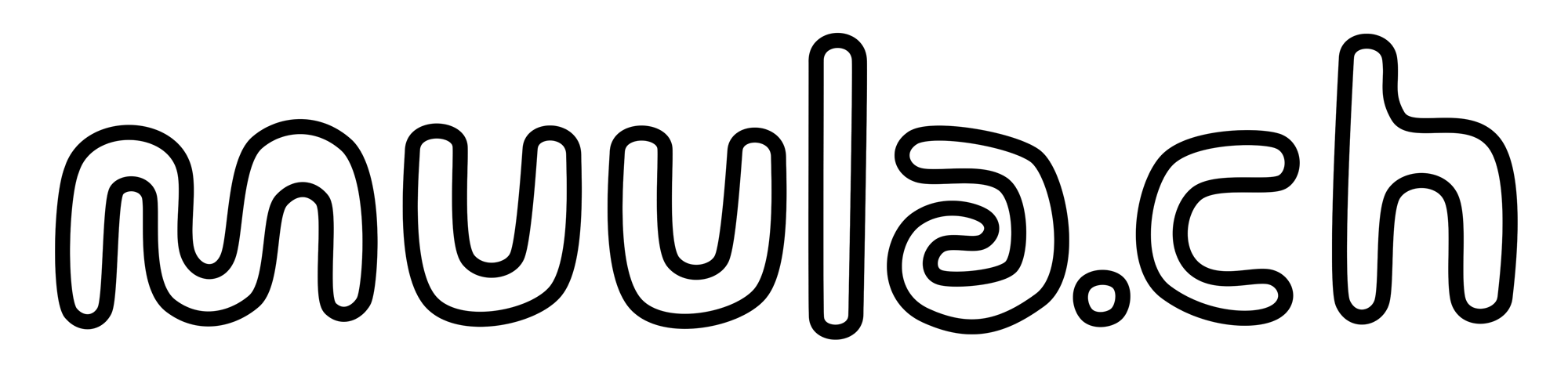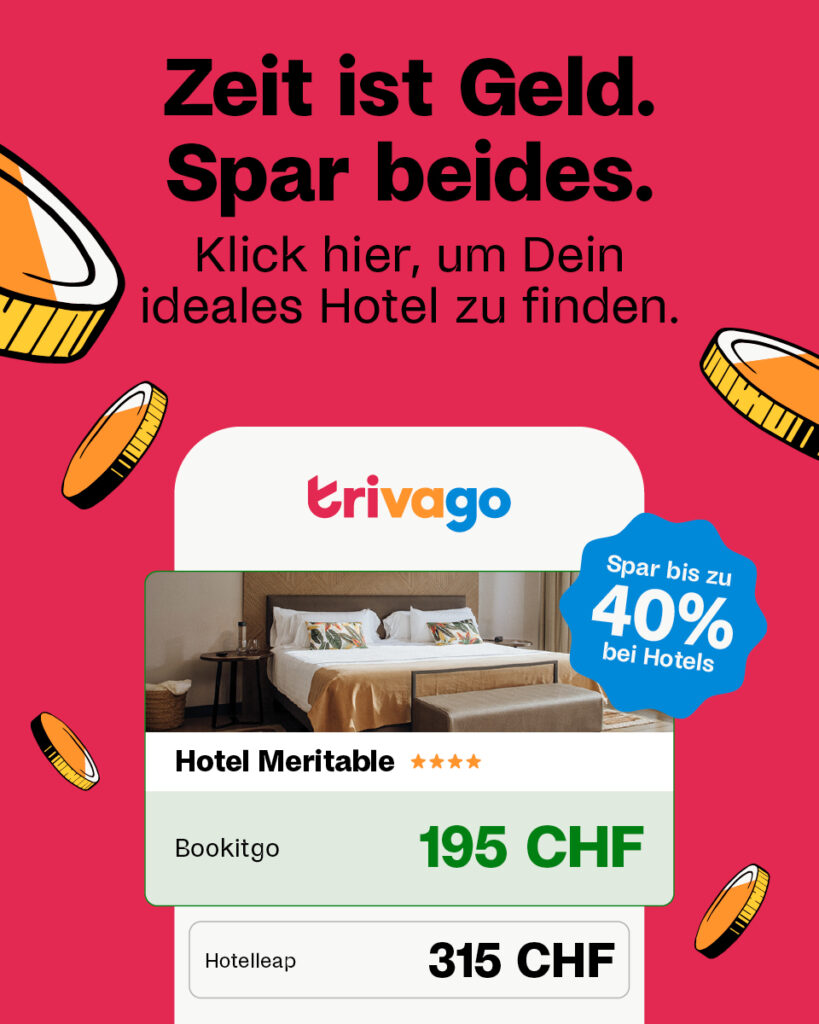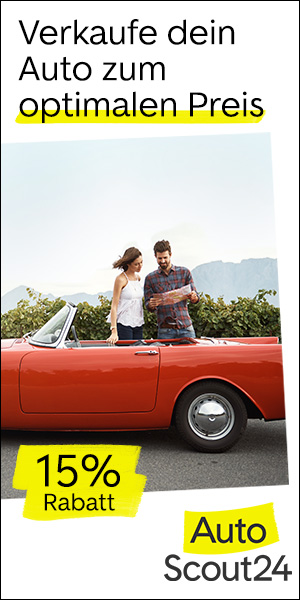Der Handelskonzern DKSH hat seine Semesterresultate vorgelegt. Von einem Megaaufschwung in Asien fehlt aber fast jegliche Spur.
Wer geglaubt hat, die Aufhebung der Coronavirus-Restriktionen in China hätte die Geschäftstätigkeit des Handelshauses DKSH (Diethelm Keller Siber Hegner) stark belebt, der ist fast vollkommen enttäuscht worden.
Der Umsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres stagnierte bei 5,6 Milliarden Franken. Organisches Wachstum und Akquisitionen werden fast vollständig von negativen Währungseffekten aufgefressen, wie aus dem DKSH-Halbjahresbericht des Zürcher Handelskonzerns vom heutigen Dienstag hervorgeht.
Deutliche Bremsspuren
Von den vier Sparten tritt besonders die grösste Healthcare bei Einnahmen von 2,8 Milliarden Franken auf der Stelle.
Das Segment Consumer Goods verringerte den Umsatz währungsbedingt um rund 4,2 Prozent beziehungsweise um 80 Millionen Franken auf 1,8 Milliarden Franken.
In der Sparte Performance Materials ging es sogar organisch um fast 4 Prozent beziehungsweise rund 30 Millionen Franken auf 767 Millionen Franken nach unten.
Magisches Wort fällt nicht
Wer noch die Resultate der Swatch-Group oder des Luxuskonzerns Richemont in Erinnerung hat, über die auch muula.ch berichtete, wird sich wundern, wie deren Geschäfte in Asien um 30, 40 Prozent zulegen konnten.
Genau da steckt der Teufel bei DKSH drin, das magische Wort China fällt an einer Medienorientierung am heutigen Dienstag in den Präsentationen des Managements um CEO Stefan Butz und Finanzchef Ido Wallach gar nicht.
Die Schweizer Luxusgüterkonzerne wuchsen nämlich in Festlandchina, Hongkong und in Macao extrem.
20 Akquisitionen getätigt
Dagegen drehen sich die ganzen Erklärungsversuche bei DKSH um Thailand, Malaysia, dem Markteintritt in die Philippinen, Vietnam und Laos.
Gewiss, bei dem Unternehmen geht es auch um Marktentwicklungen, aber China darf man da dennoch nicht zur Seite schieben. So etwas sieht wie eine Nordamerikastrategie aus, wo die USA aussen vor blieben.
Seit 2019 seien 20 Akquisitionen vorgenommen worden, erklärte CEO Butz. Von Explosion der Geschäfte, wie bei den Schweizer Uhren- und Schmuckkonzernen, fehlt dann allerdings jegliche Spur.
Die Aussagen von der Bilanzmedienkonferenz im Februar dieses Jahres, an der auch muula.ch teilnahm, wonach in Thailand ein Touristen-Ansturm bevorstünde, weil neben den Europäern nun auch die Chinesen wieder reisen könnten, scheinen völlig verpufft zu sein.
Wie gross das Wachstum im vergleichbaren Lifestyle- und Luxusuhrenbereich etwa mit der Marke Maurice Lacroix war, wollte das Management nicht verraten. Aber dieses Geschäft um Luxusuhren steht ohnehin zur Disposition.
Tritt auf der Stelle
Der Konzerngewinn stieg im ersten Halbjahr gerade mal 1,3 Prozent um minime 1,4 Milliönchen auf 107 Millionen Franken.
Währungsrisiken sichert der Konzern eigentlich ab, insofern hätte die Frankenstärke im Reinergebnis nicht so stark reinhauen dürfen.
Doch Finanzchef Wallach erklärte, dass die Währungen Thailands und Malaysias gegenüber dem Franken neue Rekord-Schwächen gezeigt hätten.
Der Blick auf die operativen Gewinne der einzelnen Sparten zeigen kaum Veränderungen zu den Vorjahres-Semesterwerten.
An der Pressekonferenz kommentierte das Management aber häufig auch nur adjustierte Geschäftszahlen, die dann besser aussahen.
Gegenläufige Effekte
Die normale Eigenkapitalrendite (RoE) erhöhte sich um 1 Prozentpunkt auf 12,4 Prozent, weil das «E» hauptsächlich mit der Auszahlung der Dividende stark sank.
Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (Ronoc) verschlechterte sich bei dem Zürcher Handelshaus um 1,3 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent, obwohl das betriebsnotwendige Kapital laut dem Finanzchef sank und die Verzinsung Ronoc dadurch eigentlich hätte zulegen müssen.
Von Aufbruchstimmung und Wachstumskurs kann schon deshalb keine Rede sein, weil der Handelskonzern binnen weniger Monate seine Belegschaft um 1400 Vollzeitstellen beziehungsweise um rund 5 Prozent auf noch 29.700 FTE reduzierte.
Vage Antworten
Der stark auf Asien ausgerichtete Konzern will dieses Jahr die Proportionen des Geschäfts in der Welt nicht verändern. Auf die Frage eines Analysten sagte Butz, 55 Prozent des Geschäfts würden weiterhin in Asien, 30 Prozent in Europa und 15 Prozent in Amerika erzielt.
Schaut man auf die Asienstrategie, dem wichtigsten Standbein von DKSH, so fällt auf, dass eben China gar keine grosse Rolle spielt.
Auch scheint sich das Management in den einzelnen Ländern dann kaum detailliert auszukennen. Als eine Analystin fragte, wie DKSH den Ausgang der Wahlen in Thailand einschätze, erklärte Butz nur, dass man abwarten und schauen müsste.
Auch sonst blieben die Antworten meist vage, aber blumig für die Zukunft. Vom langfristigen Potenzial Asien sei man überzeugt, hiess es beispielsweise.
Börse legt zu
Mit dem Geschäftsmodell kam DKSH zwar gut durch die Coronavirus-Pandemie.
Nun, wenn alle Märkte heisslaufen und Firmen in Asien selbst in Schweizerfranken noch 30 oder 35 Prozent an Einnahmezuwächsen erzielen, gehen die Geschäfte aber förmlich an dem Handelshaus vorbei. Von asiatischem Tiger fehlt jede Spur – es ist eher ein Tiger-Entchen.
An der Börse kamen die Informationen dennoch gut an. Der Kurs der DKSH-Aktien legte in einem freundlichen Marktumfeld um rund 4 Prozent zu.
18.07.2023/kut.