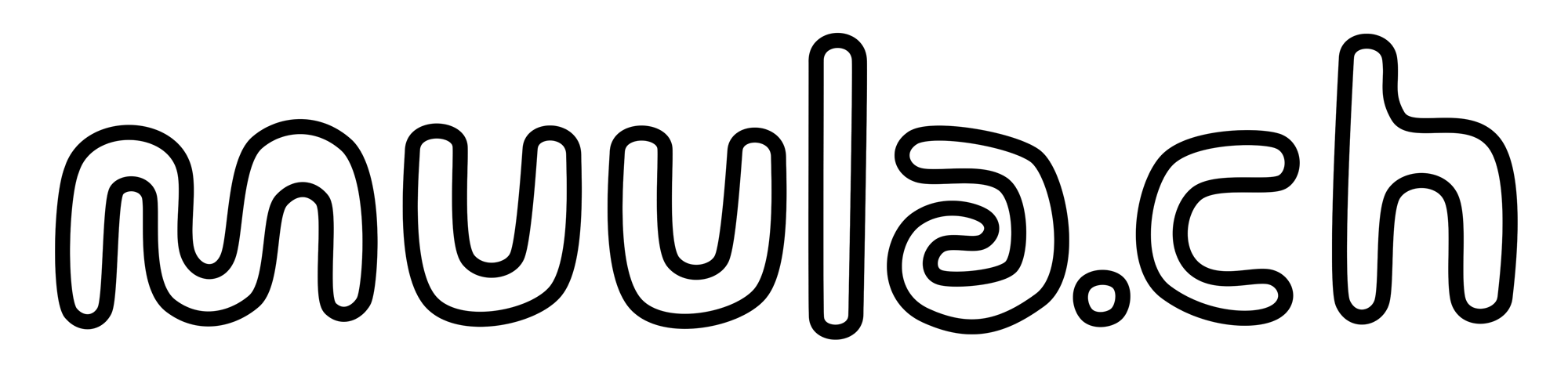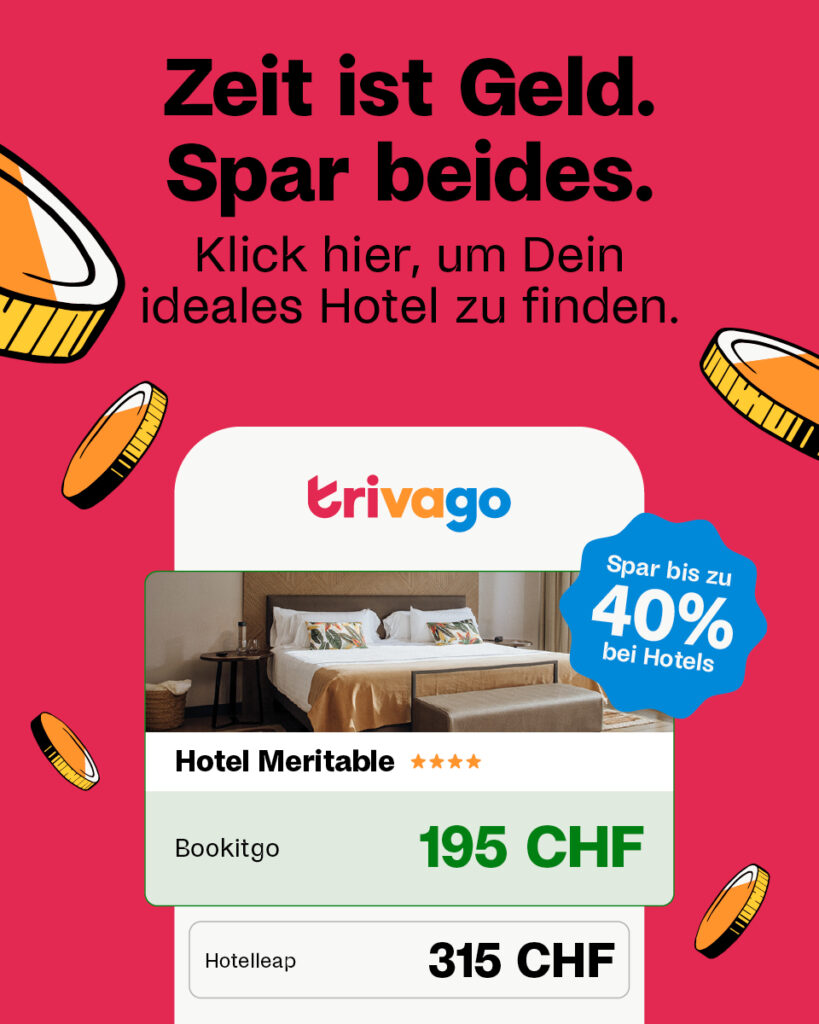Bisher sah alles so aus, als hätte sich die Grossbank UBS vehement gewehrt, die Credit Suisse zu übernehmen. Doch das stimmt wohl nicht.
Die Schweiz und eigentlich die ganze Welt retten – das war bisher die Annahme über die Hintergründe der staatlich orchestrierten Zwangsfusion zwischen den zwei Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse (CS).
Wie zahlreiche Medien berichteten, geht aus Dokumenten der UBS an die US-Börsenaufsicht SEC aber eine ganz andere Geschichte hervor.
Sogar externe Berater
Die Einverleibung der Krisenbank CS durch die UBS war demnach von langer Hand geplant gewesen.
So beauftragte der Verwaltungsrat der UBS die Geschäftsleitung schon Wochen vor der Bekanntgabe des Deals, sich auf ein solches Szenario ganz konkret vorzubereiten.
Dazu wurden sogar auch externe Berater engagiert, wie aus dem Dokument weiter hervorgeht.
Gleichzeitig durchforsteten die Finanzexperten die CS, wo Risiken in den Bilanzen schlummern könnten.
Formell steht aber in Aufzeichnungen geschrieben, dass die UBS keinen solchen Deal anstrebe, weil sonst hätte ihn der UBS-Verwaltungsrat auch sofort umsetzen müssen.
Rasch vollendete Tatsachen
Insofern verwundert es nicht mehr, dass die UBS quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion des Bundes sofort auf das Geschäft einging und die taumelnde CS übernahm.
Auch der Integrationsprozess scheint daher viel schneller zu gelingen, was vielerorts grosse Augen hervorbrachte.
Starbanker und UBS-Konzernchef Sergio Ermotti hatte diese Woche angekündigt, das Closing der Fusion sei schon für Ende Mai oder Anfang Juni vorgesehen. Das war schon sehr merkwürdig, wie muula.ch berichtete.
Merkwürdige Klausel
Das Finanzportal «Inside Paradeplatz» berichtete am heutigen Freitag sogar von einer sogenannten Poison Pill, einer Giftpile, also einer speziellen Bedingung im Kaufvertrag der CS, gemäss der für die CS nur ein Zusammenschluss mit der UBS attraktiv war.
Im Falle eines Alternativangebotes, das einen höheren Kaufpreis für die Aktien der CS offeriert hätte, hätte die CS in jedem Fall die Hälfte der Differenz zum Angebot der UBS sofort überweisen müssen.
Solche Klauseln kommen in Verträgen häufig vor, damit die Anreize für ein gewünschtes Ergebnis richtig gesetzt sind.
100 Millionen an Übernehmer
In diesem Fall ist es klar zugunsten der UBS geschehen. CS hatte mit dieser Bedingung weder ein Interesse an einem anderen Bieter, noch an einem höheren Kaufpreis.
Ein Unternehmen, das extreme Liquiditätsschwierigkeiten hat, würde wahrscheinlich nicht auf eine solche umgehende Zahlungsverpflichtung eingehen.
Übernehmende, welche diesen Betrag durchaus im Namen der CS hätten überweisen können, wird der Deal damit aber ebenfalls unattraktiv, weil sie das Geld noch oben auf den eigentlichen Kaufpreis draufsatteln müssten und damit die Transaktion weniger lukrativ wird.
Laut dem Portal hätte die CS in jedem Fall 100 Millionen Franken zahlen müssen, falls kein Deal mit der UBS zusammengekommen wäre.
Zurück zur Grossbank
Langsam, aber sicher kommt also Licht ins Dunkel der Angelegenheit.
Ermotti, der beim Rückversicherer Swiss Re als Verwaltungsratspräsident eine unglückliche Figur gemacht hatte, wie auch muula.ch berichtete, soll sich dort ohnehin schon Anfang des Jahres dahingehend geäussert haben, dass er zurück in die Bankenwelt wechseln wolle.
Auch die Fusion von UBS und CS sei dabei wohl ein Thema gewesen.
Keine Schrumpfung geplant
Analytiker hatten sich ausserdem unlängst gefragt, wie die UBS binnen weniger Tage rund 70 Millionen Dollar für Beratung zur CS-UBS-Fusion ausgeben konnte, wenn der Deal doch quasi nur an einem Wochenende ausgehandelt worden war.
Die Zahl hatte die UBS im Quartalsbericht genannt und hatte Stirnrunzeln hervorgerufen, wie auch muula.ch berichtete.
UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher will mit den Wall-Street-Banken ein Rennen aufnehmen und braucht dazu Grösse.
Ex-UBS-CEO Ralph Hamers, der von Starbanker Ermotti von seiner Position verdrängt wurde, hatte zum Auftakt der Monsterfusion an die Belegschaft eine Nachricht geschickt, in der er das Personal motivieren und auf die «growth story» mitnehmen wollte.
Es geht also klar um Grösse und nicht um eine Schrumpfung der «Monsterbank».
Bund als Gehilfe
Und noch eine interessante Passage befindet sich in dem SEC-Dokument.
Auf Seite 32 steht geschrieben, dass die UBS Group AG und die Schweizer Regierung über ein Abkommen zur Teilung der Verluste sprechen würden, falls in einem bestimmten Portfolio die Verluste 14 Milliarden Franken übersteigen würden.
Dies hatte der Bund bisher immer bestritten, wie auch muula.ch zum Desaster-Deal von Finanzministerin Karin Keller-Sutter berichtete.
Alles scheint somit von der Grossbank UBS von langer Hand geplant.
Die Schweizer Behörden waren dabei aber wahrscheinlich nur die Steigbügelhalter.
05.05.2023/kut.