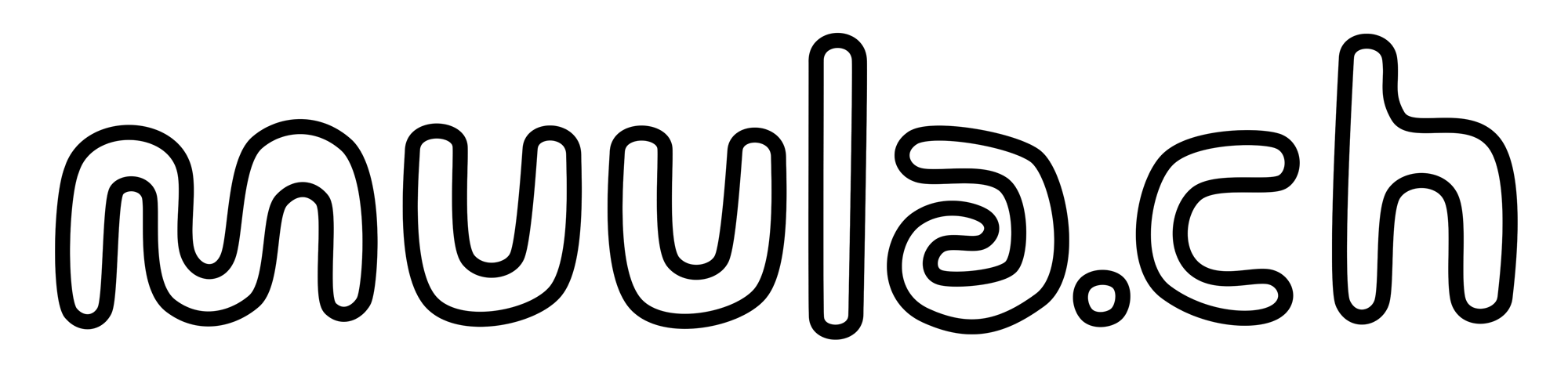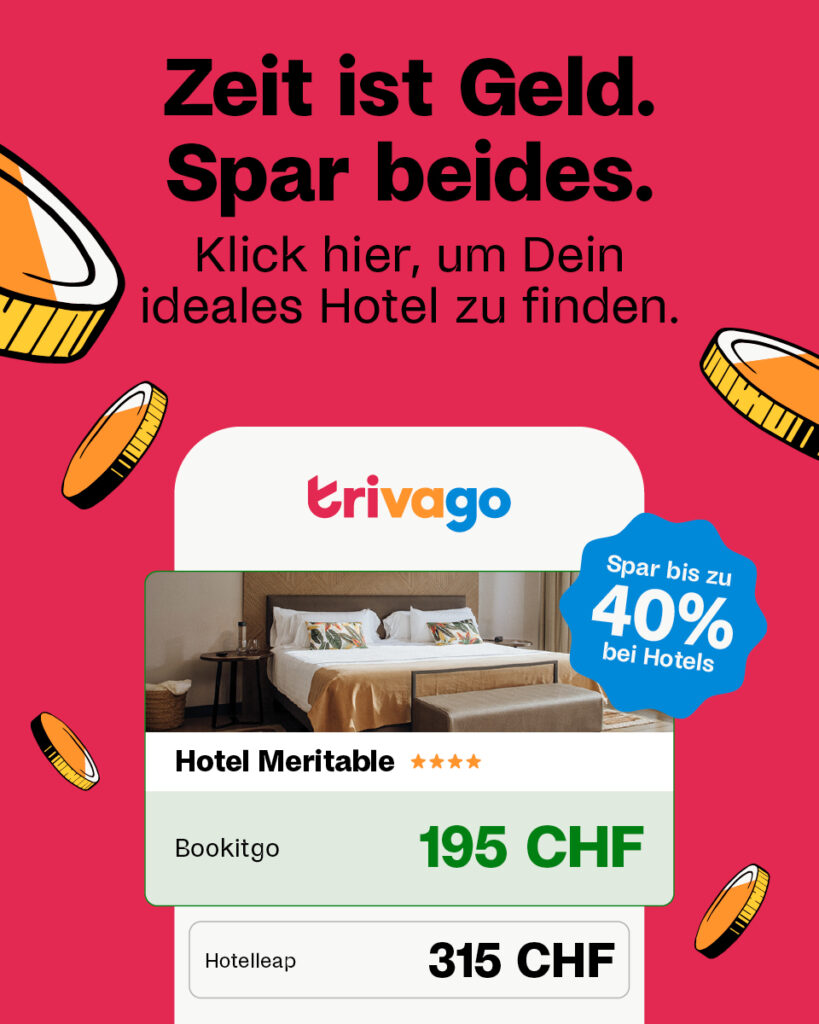Warum musste die Schweiz binnen kürzester Zeit sowohl die UBS als auch die Credit Suisse retten? In Zürich gab es eine Antwort auf die knifflige Frage.
Ein Historiker ist immer in einer besseren Position als ein Feldherr. Dies wurde auch an der Veranstaltung «Finance Circle» der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW klar, die am Montagabend in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Bankenverband stattfand.
Schrumpfung der Eigenmittel
Es bringt eben mehr, mit Distanz auf Ereignisse zu blicken, als mittendrin zu sein, um die tatsächlichen Entwicklungen sowie die Ursachen für die Geschehnisse genau zu erkennen.
So zeigte der Historiker Robert U. Vogler an der Veranstaltung in Zürich auf, dass die Eigenkapitalquoten der Banken seit der frühen Hochphase der Schweizer Geldhäuser von über 50 Prozent auf nur noch rund 5 Prozent geschrumpft sind.
Mit dem Einbruch schmolzen auch die Haftungen der Banken dahin.
Gleichzeitig legte Vogler dar, dass die Summe der drei grössten Kreditinstitute des Landes international gesehen – entgegen der vorherrschenden Meinung – praktisch immer nur Zwerge und somit 2. Liga oder sogar nur 3. Liga waren.
Unfähige Verwaltungsräte
Mit dem Bankkundengeheimnis, der politischen Stabilität und der starken Heimwährung ging es aber für die Schweizer Banken immer weiter aufwärts, bis der Tag der Wahrheit kam und eines der Verkaufsargumente, nämlich das Bankgeheimnis, wegfiel und die Kundschaft ihren Fokus auf den tatsächlichen Werterhalt sowie Wertsteigerungen richteten.
Dabei hätten die Kunden aber auch nur Mittelmässigkeit feststellen können, so der Historiker Vogler.
Als Schwächen des Finanzplatzes sah er die Inkompetenz bei den Verwaltungsräten sowie das Nichtbeherrschen von Geschäftsfeldern.
Auch die fehlende Swissness und die Eigengeschäfte gepaart mit falschem Risikobewusstsein wurden den Schweizer Banken zum Verhängnis, lautete das Fazit seines Rückblicks.
Fehlender Prozess
Doch treten dann Bankenvertreter vor das Publikum, kommen die Anwesenden aus dem Staunen kaum noch heraus.
Die Regulierung habe insgesamt gut funktioniert und das Lohnsystem bräuchte keine Anpassungen, sagte etwa Roman Studer, Chef der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg, der ebenfalls Historiker ist, und es eigentlich besser wissen müsste.
Der Untergang der Credit Suisse (CS) habe im fehlenden Vertrauen der Kunden gelegen und dies könne kein Regulator noch so genau beaufsichtigen, erklärte Studer weiter. Geschweige denn, die Finanzmarktaufsicht könne rechtzeitig eingreifen.
Als Ursache für die Nichtanwendung des CS-Rettungsplanes gab die SBVg an, dass die US-Börsenaufsicht SEC dem Finma-Entscheid über eine Abwicklung der systemrelevanten Grossbank hätte zustimmen müssen und dieser Prozess noch nicht aufgegleist gewesen sei.
Wenig Umverteilung am Markt
Auch der CEO der Zürcher Kantonalbank, Urs Baumann, der die Staatsbank mit einer Bilanzsumme von rund 200 Milliarden Franken seit Kurzem führt, sah keine Probleme am Finanzplatz Schweiz. Der Wettbewerb funktioniere trotz der Notfusion der CS hervorragend, sagte er mit Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder.
Der «CS-Effekt» sei zudem viel kleiner als oftmals angenommen, erklärte er. Im Jahr 2023 dürften am ganzen Finanzmarkt des Landes lediglich rund 800 Millionen Franken an CS-Geldern zu anderen Banken wandern, hiess es.
Dieser Betrag käme zu den 6 Milliarden Franken, die ohnehin jedes Jahr von der Kundschaft umgedeckt würden.
Tabu bei Eigenmitteln
Höheren Eigenkapitalquoten erteilte der ZKB-Chef obendrein eine klare Absage.
Am Beispiel von 15 Prozent zeigte Baumann, dass der Kanton Zürich rund 20 Milliarden Franken in die Staatsbank einschiessen oder Jahrzehnte lang auf Dividendenausschüttungen verzichten beziehungsweise die ZKB rund 60 Prozent ihrer Hypotheken kündigen müsste, um dieses Ziel zu erreichen.
All dies sei utopisch und sollte der Politik einmal klargemacht werden, betonte der Bankmanager.
Sanktionen als Risiko
Die Schweiz solle den Blick auf das Wesentliche nicht verlieren, und dies sei etwa die Cybersecurity, geopolitische Turbulenzen, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, ein verändertes Kundenverhalten sowie die zunehmenden regulatorischen Anforderungen.
Eines der grössten Risiken für die Schweizer Kreditinstitute sei zudem, dass sich der Bundesrat irgendwelchen Sanktionen anschliesse und dadurch Kunden bei Schweizer Geldhäusern betroffen wären, die eigentlich viel Vertrauen in die Schweiz gesetzt hätten.
Regulierung hinkt hinterher
Aus alldem wurde das Hauptproblem des Schweizer Finanzplatzes deutlich. Die Bankenwelt will eigentlich nichts im Lande ändern und weitermachen wie bisher.
Auf die Frage vom Moderator des Abends Mark Dittli, Chefredaktor von «The Market», wer denn Lehren aus den Rettungsaktionen ziehen und dann Reformen vorantreiben sollte, fiel den Anwesenden niemand ein.
Es träten ja immer andere Probleme auf als man aus dem jüngsten «Unfall» gelernt habe, so der Tenor etwa von der SBVg. Damit hinke die Regulierung immer hinterher.
Nebelgranaten von der Lobby
Peinlich endete der Abend, als Dittli die Referenten bat, auf einer Skala von 1 bis 10 anzugeben, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es sei, dass die UBS in Zukunft nicht auch wieder vom Staat gerettet werden müsste.
Historiker Vogler gab sich noch vorsichtig und stufte die Situation aufgrund seiner Erfahrung mit 5 bis 6 ein. Der CEO der ZKB war bei der Frage dagegen zuversichtlich, dass es bei der UBS mit 8 Zählern nicht wieder zu einem Betriebsunfall käme.
Und der CEO der Bankiervereinigung Studer sagte, mit fehlender Swissness und eigentlich schon dreist, 10, wonach eine Rettung der neuen Monsterbank UBS völlig unwahrscheinlich sei.
Damit wurde aber letztlich klar, dass bei alldem das Schweizer Volk der Dumme in der Runde ist. Wenn die UBS nämlich zum Notfall wird, sind die Studers dieser Welt mit den Taschen voller Geld über alle Berge.
Und die Historiker dürfen dann die Scherben der Feldherren zusammenkratzen.
21.11.2023/kut.