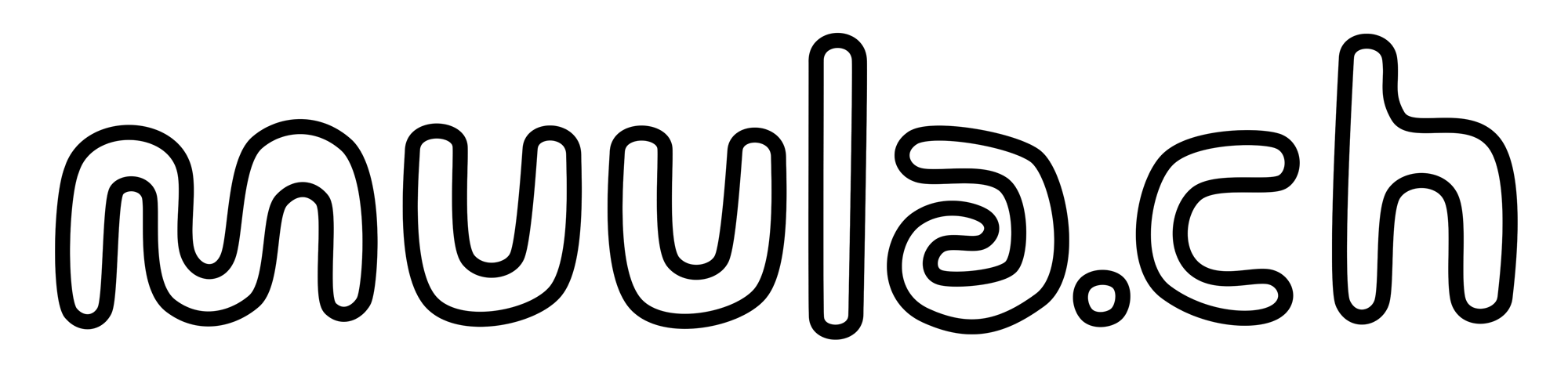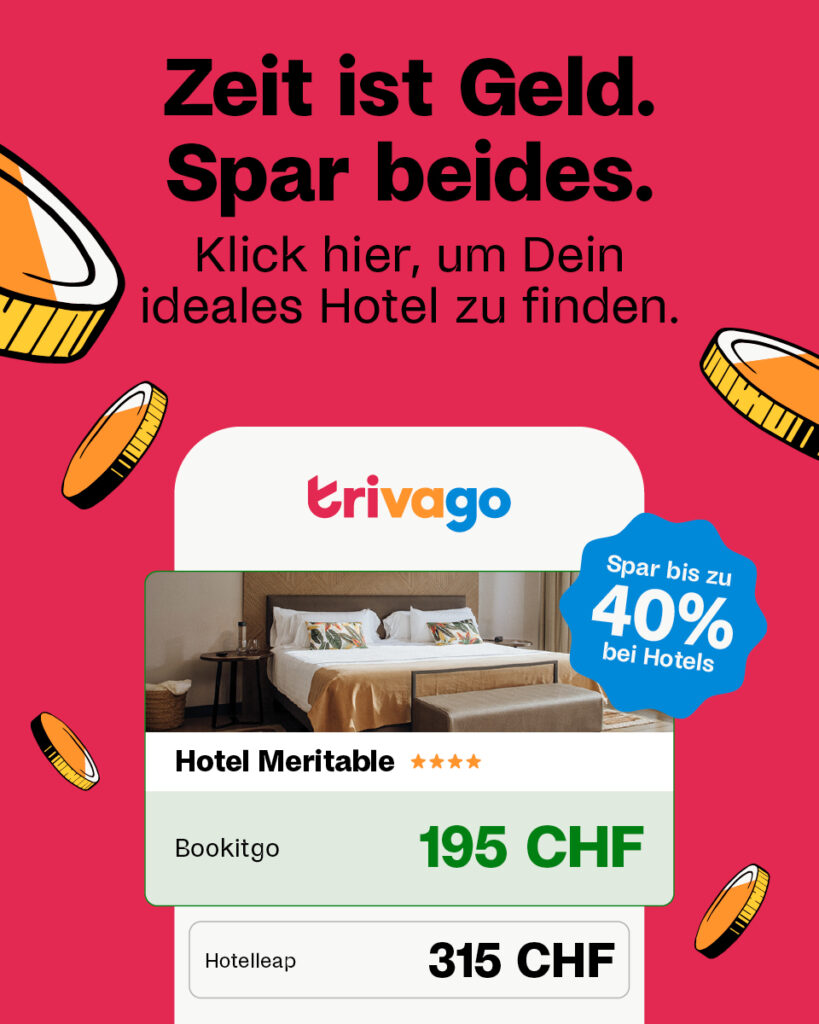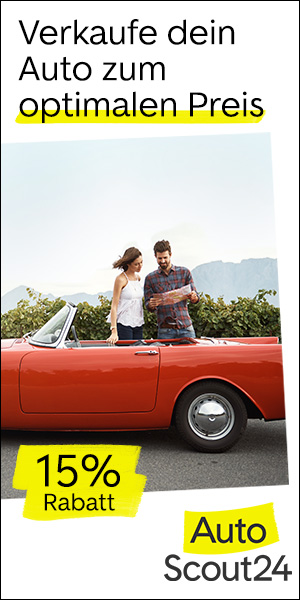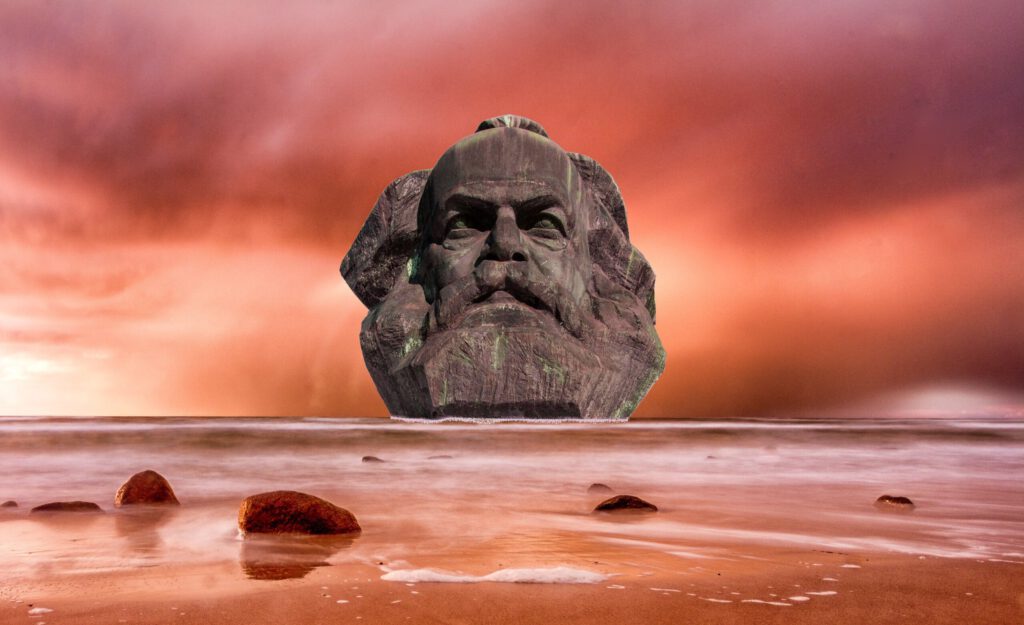
Brauchen Staaten neue Einnahmen, werden Politiker kreativ. Doch gegen neue Finanztransaktionssteuern findet die Schweiz gute Argumente.
In Zeiten klammer Staatskassen wollen Politiker von Links bis Rechts neue Einnahmen genieren.
Zur Sanierung des Sozialwerks AHV wollen die Linken beispielsweise Reiche mit einer Kapitalmarktsteuer verstärkt zur Kasse bieten.
Bereits Milliarden gescheffelt
Das Thema kommt in der Schweiz regelmässig auf und ist auch derzeit wieder im Gespräch.
Finanztransaktionen kommen durch den Austausch finanzieller Vermögenswerte gegen andere finanzielle Vermögenswerte zustande, und da dies vermehrt Reiche betrifft, wollen Sozialisten die Kapitalisten genau an dieser Stelle schröpfen.
Die Schweiz kennt mit der Emissionsabgabe, die jährlich Erträge von durchschnittlich 250 Millionen Franken einbringt, und der Umsatzabgabe, die durchschnittlich 1,3 Milliarden Franken pro Jahr an Staatseinnahmen generiert, bereits heute zwei Finanztransaktionssteuern, teilte der Bundesrat unlängst in einer Analyse zu dem Thema mit.
Die Abgaben werden in Form je einer Wertschriftentransaktionssteuer im Primär- beziehungsweise im Sekundärmarkt erhoben.
Die Schweizerische Bankiervereinigung SBVg erklärte zu dieser Thematik sogar, dass die Schweiz mit ihren «Stempelabgaben» seit 1918 bereits eine der umfassendsten Finanztransaktionssteuern der Welt habe.
Andere Möglichkeiten überlegen
Eine Finanztransaktion stellt aber lediglich eine Vermögensumschichtung dar, die kein Einkommen schaffe und damit auch keine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, hiess es weiter vom Bundesrat.
Steuern, welche Vermögenseinkommen in Form von Kapitalerträgen und Kapitalgewinnen belasteten, seien daher einer Finanztransaktionssteuer unter dem Aspekt der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit überlegen.
Belasten vom Sparen
Wie andere Steuern, die das Vermögenseinkommen oder den Vermögensbesitz direkt oder indirekt belasten, verzerre eine Finanztransaktionssteuer den Entscheid zwischen Sparen und Konsum zulasten des Sparens, mahnte die Landesregierung weiter.
Diese Sozialismus-Steuer kann sogar die Kapitalbeschaffung inländischer Unternehmen verteuern und via verminderte Kapitalakkumulation, weniger kapitalintensive Produktion und geringere Arbeitsproduktivität die Löhne senken, hiess es kritisch vom Bundesrat.
Flexible Kapitalmärkte
Darüber hinaus beeinträchtigt eine Finanztransaktionssteuer die inländische Finanzintermediation.
Da Finanzmärkte zum Teil geografisch flexibel sind, kann eine Finanztransaktionssteuer bewirken, dass die Erbringung von Finanzdienstleistungen vom Schweizer Finanzplatz ins Ausland verschoben wird.
Soweit dies der Fall ist, generiert eine solche Steuer nicht nur keinen Steuerertrag, sondern die Schweiz verliert überdies Wertschöpfung und damit Einnahmen aus anderen Steuern.
Schweden als Mahnmal
In einer Untersuchung zeigte der Think-Tank Avenir Suisse, dass Schweden zwar 1984 eine Finanztransaktionssteuer eingeführt hat und ständig daran herumbastelt.
Das Resultat: Über die Hälfte des schwedischen Aktienhandels verlagerte sich bis 1990 nach London, der Obligationenhandel brach in der ersten Woche trotz des Steuersatzes im Promillebereich um 85 Prozent ein und der Derivatehandel verschwand praktisch vollständig.
Am besten lässt die Schweiz also die Finger davon.
Von Devisen zu Wertschriften
Um diese Abgaben gibt es seit bald 100 Jahren immer wieder Streit. Schon 1936 hatte der britische Ökonom John Maynard Keynes die Lenkungswirkungen diskutiert.
Von Transaktionen auf den Devisenmärkten hat sich das Thema mittlerweile auf alle Wertschriften verlagert.
Bei Banktransaktionen würde am ehesten eine Steuer auf Neuhypotheken substanziellere und stabile Mehreinnahmen generieren, da sie weniger Ausweichreaktionen auslöst als andere Formen einer Banktransaktionssteuer. Diese würde aber die Hypotheken verteuern, was in der Schweiz wohl kaum jemand will.
OECD-Mindeststeuer schreckt ab
Damit das Argument der Abwanderung aber nicht mehr gelten kann, schliessen sich die Beamten vieler Länder über Organisationen, wie die OECD, zusammen. Dann können Bürger und Firmen den Abgaben nicht mehr entrinnen.
Doch wie schlecht so ein Kartell funktioniert, kann die Welt an der OECD-Mindestbesteuerung sehen. Die Schweiz preschte als Musterschüler vor. Die USA erhöhten überall den Druck zur Einführung der Steuer – und setzten sie dann gar nicht erst um.
19.05.2025/kut.