
Die Schweizerische Nationalbank verliert rasant ihr Hauptarbeitsinstrument. Doch statt sich darauf einzustellen, blockiert die SNB lieber die Entwicklungen.
Wer mal nicht weiter weiss, gründet einen Arbeitskreis.
Diese Redensart passt derzeit gut auf die Schweizerische Nationalbank SNB.
Zukunft ist bargeldlos
Im Jahr 2017 beglichen Menschen in der Schweiz ihre Zahlungen vor Ort noch zu über 70 Prozent mit Bargeld. Doch im Jahr 2024 waren es bloss noch 30 Prozent.
In ganz Europa zeigt sich der Trend weg von Bargeld und hin zu bargeldlosen Zahlungen.
Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten, denn quasi kein normaler Mensch setzt noch Bargeld ein.
Extrem teure Abwicklung
Die Nutzung von Barzahlung wird nämlich stark gehemmt.
Einerseits gibt es immer weniger Annahmestellen im Detailhandel, bei Kulturveranstaltungen sowie im öffentlichen Verkehr, welche Münzen und Geldscheine überhaupt noch annehmen.
Anders als etwa in Deutschland gibt es in der Schweiz nämlich keine Annahmepflicht für Bargeld. Wer seine Kundschaft über die Ablehnung von Münzen und Geldscheinen informiert, braucht sich um Bargeldzahlungen keine Gedanken mehr zu machen.
Allenfalls verlieren Unternehmer deshalb etwas Umsatz. Doch das Abrechnen, Verrechnen und das Bringen des Geldes zum Tresor kosten meist viel mehr.
Einlenken auf Zürcher Weihnachtsmarkt
Selbst Staatsbetriebe, wie die Schweizerischen Bundesbahnen SBB, bauen einen Fahrkartenautomaten nach dem anderen ab, an dem die Kundschaft noch hätte mit Bargeld zahlen können.
Der Zürcher Weihnachtsmarkt mit einem Verbot von Bargeld ist derzeit zum Symbol für das Problem geworden.
Erst nach Protesten über den Kartenzahlungszwang lenkten die Verkaufsstellen zähneknirschend ein.
Schwierige Bargeldbeschaffung
Andererseits wird es in der Schweiz immer schwieriger, überhaupt an Bargeld zu kommen.
Die Zahl der Geldautomaten und Bankschalter von UBS, Raiffeisen, ZKB & Co. sowie der Poststellen nahm in den vergangenen Jahren rasant ab.
Selbst Staatsbetriebe, wie die Postfinace, bauen einen Postomaten nach dem anderen ab, wo Bürger noch Bargeld hätten beziehen können.
Niemand rennt dann aber ewig in der Gegend herum, um an Bargeld zu kommen, und womöglich noch hohe Gebühren dafür auszugeben.
Geldpolitik anders ausrichten
Wenn es aber immer schwieriger wird, mit Bargeld zu zahlen und überhaupt an die Geldscheine zu kommen, ist es logisch, dass Menschen mit Geld-, Debit- oder Kreditkarten zahlen.
Auch das «Tappen» mit Apps oder Smartphones hat sich an den Kassen der Schweiz etabliert.
Dadurch wird es allerdings für die Schweizer Zentralbank schwieriger, die Geldpolitik durchzusetzen, weil ihr Hauptarbeitsinstrument langsam, aber sicher verschwindet.
Wenn nur noch ein paar Menschen mit Verfolgungswahn oder ein paar Kriminelle auf Bargeld setzen, funktioniert das althergebrachte Finanzsystem nicht mehr.
Altbackenes konservieren
Seit Jahren tagt daher regelmässig eine Expertengruppe, um das Zugangsnetz zu Bargeld weiterzuentwickeln.
Früher war es wegen Krisensituationen wichtig, neben den Geldautomaten der Banken noch ein separates Netz bei der Schweizerischen Post um Postfinance zu haben.
Doch kein Finanzinstitut will mehr die enormen Kosten und den hohen Energieverbrauch für das 24-Stunden-System tragen, wenn Bargeld ohnehin kaum noch bezogen wird.
Nun sollen die Schweizer Börse SIX und die Post die gemeinsame Nutzung von Bargeldzugangsstellen durch verschiedene Anbieter («Pooling») prüfen, wie die SNB und die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV am Freitag bekanntgaben.
Anonyme Transaktionen möglich
Ein Weg in die Zukunft ist dies jedoch nicht.
Die Menschen brauchen auf der ganzen Welt vielmehr einen digitalen Franken. Dabei verweigert sich die SNB aber der Realität.
Ein wichtiges Gegenargument der Zentralbanker ist die Nachvollziehbarkeit der Bezahlvorgänge auf Blockchains. Bargeld gewährt bis zu gewissen Grössenordnungen eine Anonymität.
Doch dafür gibt es auf Blockchains längst kryptographische Lösungen mit dem Mischen der Transaktionen bis zur Unkenntlichkeit oder mit dem sogenannten ZCash, bei dem Bezahlvorgänge anonym geprüft werden können, ohne die Transaktion selbst preiszugeben.
Ausland schafft Schweizer Geld
Statt also einen Runden Tisch für das Althergebrachte zu zelebrieren, sollte die SNB unter der Leitung von Martin Schlegel lieber einen Arbeitskreis zur Zukunft ihrer Geldpolitik aufgleisen.
Das Zusammenspiel der Geschäfts- und Notenbanken sowie der Zinswirkungen in der neuen Krypto-Welt sind nämlich alles andere als klar.
Die Tage des Bargelds sind gezählt, und wenn die Schweiz keinen Franken-Stablecoin auf den Markt bringt, machen es eben andere.
Dollar-Stablecoins wie USDT, USDC & Co. gibt es bereits zu hunderten Milliarden.
Der Schritt zu einem Franken-Stablecoin ist da nicht weit und sogar teils schon in Planung, wie Recherchen von muula.ch ergaben.
Schwierige Situation vermeiden
Dann wird es für die Schweizer Zentralbank jedoch noch schwieriger, eine selbständige Geldpolitik durchzusetzen.
Ein nicht an die SNB gebundener digitaler Franken könnte in einer Krise abstürzen und dem Land sowie seinen Bürgern enorm schaden.
Es braucht schon einen Arbeitskreis, wenn die SNB nicht weiterweiss. Doch es muss der Richtige sein.
22.11.2025/kut.
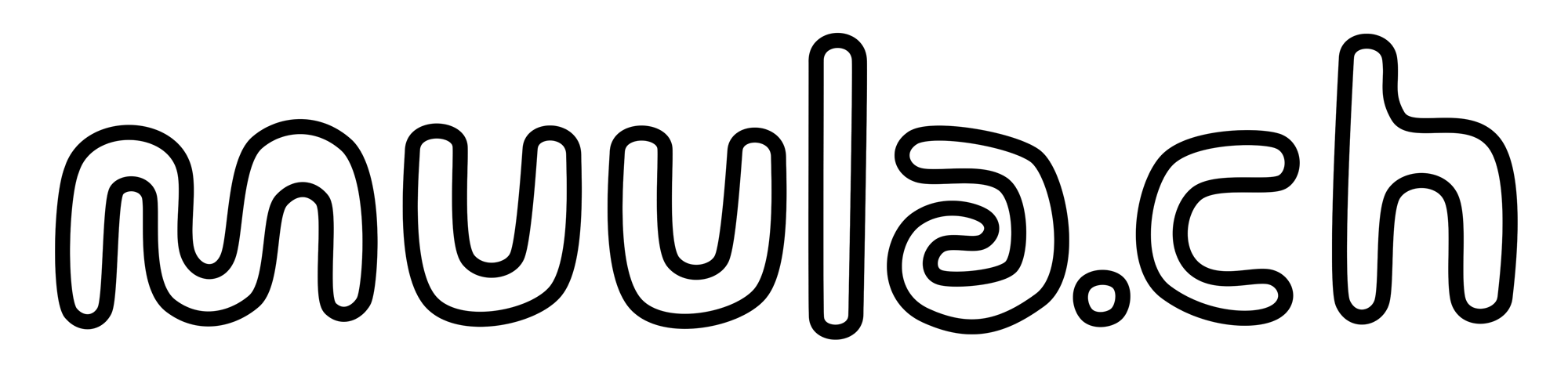
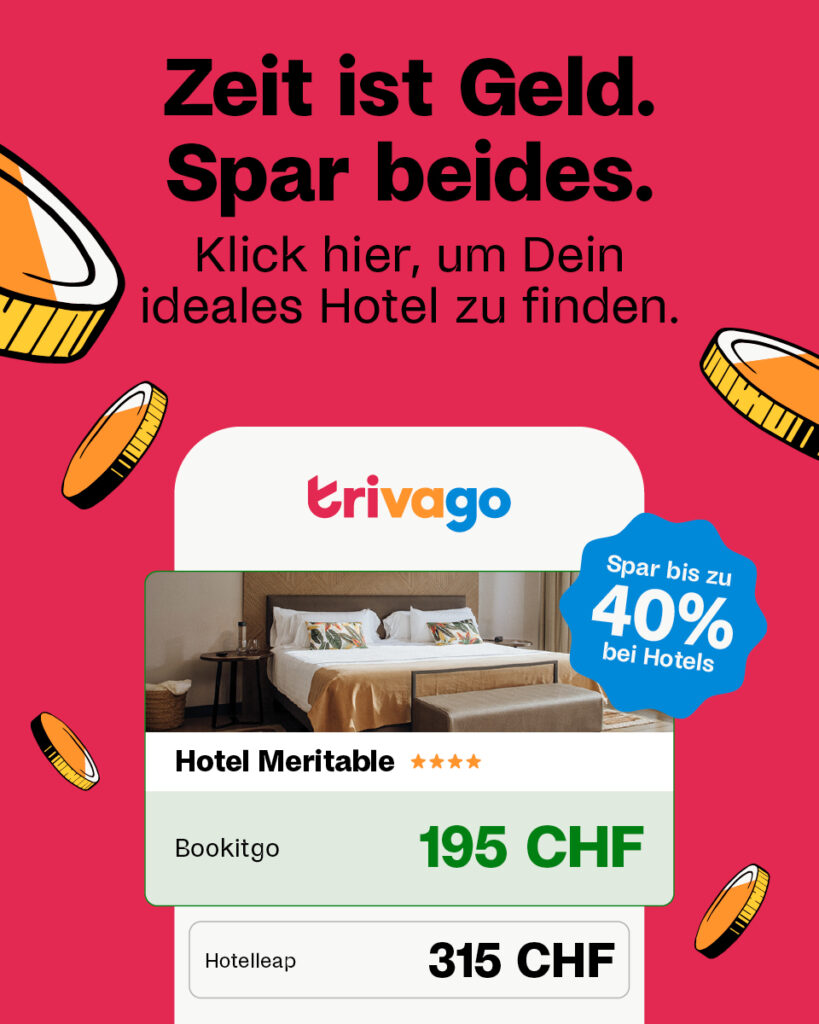



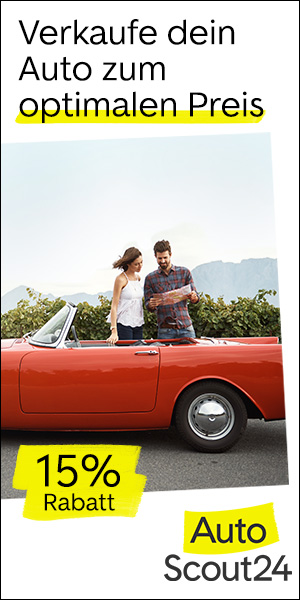
Ich finde es richtig zugang zu Bargeld zu erhalten und in diesem Bericht finde ich die vertretene Haltung nicht korrekt. Es werden grundsätzlich Bargeldzahler in eine Schublade geschoben wie dies oft passiert. Bargeld ist wichtig, da wir unsere Technik nur begrenzt beherschen wie die Vergangenheit der letzten Jahre verdeutlicht.
Die snb sollte einen Digitalen Franken und die nötige Infrastruktur dafür zu verfügung stellen. Dabei sollte aber klar auf Crypto/Stablecoins verzichtet werden.
Ganz einfach eine digitale Wallet von der Snb mit der man einfach, sicher , und GRATIS geld senden kann. Am besten so gebaut dass es auch beschränkt offline funktioniert.