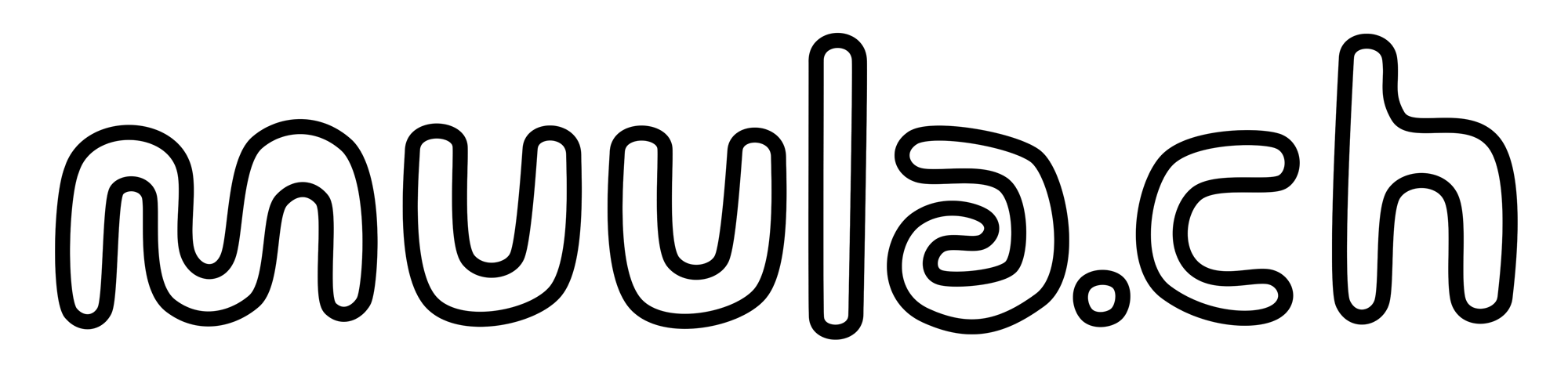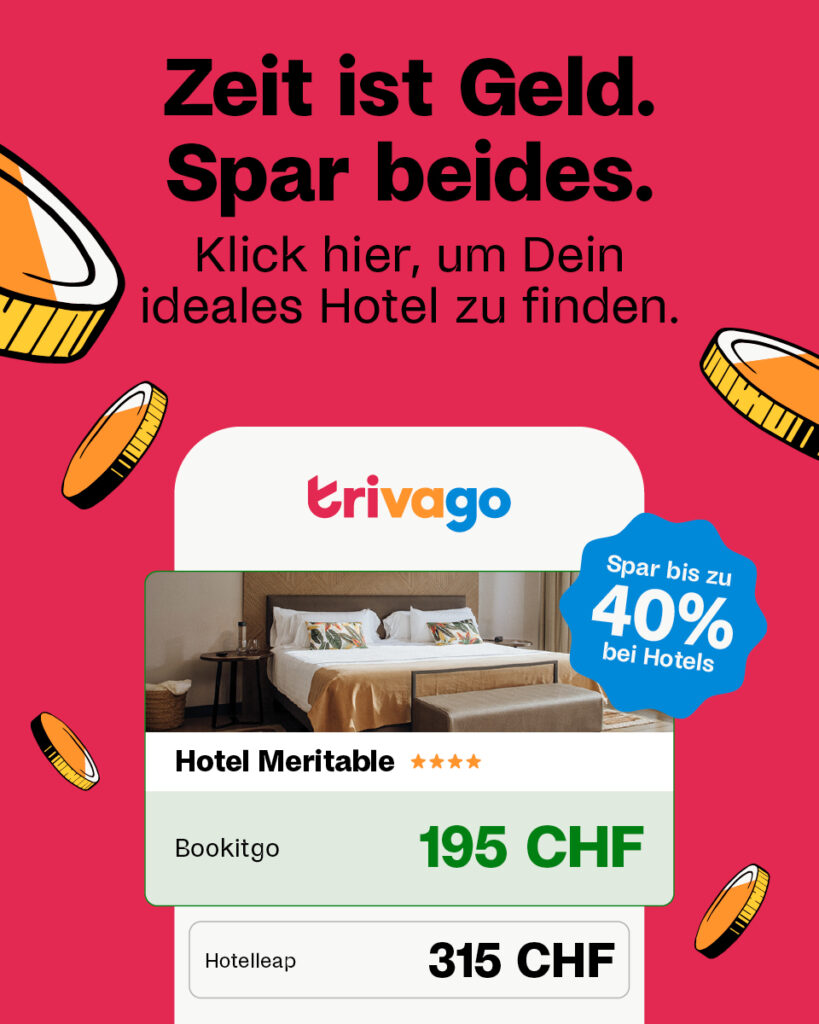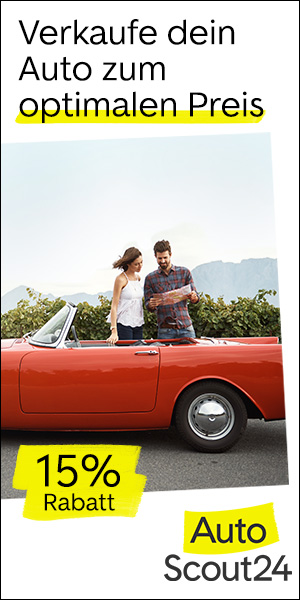Mehr Schweizer entscheiden sich für den Kapitalbezug in der 2. Säule. Doch die Freude über das wegfallende Langlebigkeitsrisiko ist teils getrübt.
Eine der schwierigsten Entscheide im Leben von Schweizern liegt in der Beruflichen Vorsorge.
Bei der Pensionierung müssen sie festlegen, ob sie eine lebenslange Rente oder das Vorsorgekapital beziehen wollen oder eine Mischung aus Rente und Kapitalbezug.
Verdopplung des Volumens
Wie sollen sich die Menschen da entscheiden? Sterben Pensionäre kurz nachdem die Rente bezogen wurde, wäre das Kapitalwahlrecht besser gewesen.
Lebt eine Person bis in alle Ewigkeiten, wäre der Rentenbezug logischerweise die richtige Wahl gewesen.
Nun entscheiden sich immer mehr Schweizer für den Kapitalbezug – und dies teils sogar zu 100 Prozent.
In zehn Jahren stieg die Zahl der Personen um mehr als 50 Prozent, die sich ihr Alterskapital auszahlen lassen. Sinkende Umwandlungssätze tragen dazu bei.
Durch längeres Einzahlen und höhere Verdienste gab es innerhalb einer Dekade aber auch eine Verdopplung des Volumens der Kapitalbezüge.
Schweizer werden immer älter
Doch was bedeutet die Verschiebung der Altersleistungen hin zum Kapital, welche den Menschen mehr private Flexibilität im Alter und die eigene Anlagemöglichkeit bietet?
Dies wurde an einem Seminar der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZAHW zum Thema «Vision PK 2030» klar, das in Kooperation mit dem Vermögensverwalter Candriam unlängst durchgeführt wurde.
Aus Sicht der Pensionskasse ist eine Kapitalauszahlung risikomindernd, da das Langlebigkeitsrisiko wegfällt, erklärte etwa Emmanuel Ullmann, Geschäftsführer der Pensionskasse Solothurn, an der Veranstaltung.
Klar, wenn die Menschen immer älter werden, müssen die Vorsorgeeinrichtungen dieses Risiko nicht mehr tragen, wenn die Versicherten das Kapital beziehen. Insofern sind die Entwicklungen positiv.
Liquide Investments nötig
Doch die Freude darüber könne sich als Bumerang erweisen, denn das Kapitalwahlrecht könnte zu einem negativen Gesamtcashflow führen, hiess es weiter.
Die Vorsorgeeinrichtungen müssten diesen Umstand, dass immer mehr Versicherte ihre Altersleistungen auf einen Schlag in bar haben wollen, daher in ihrer Anlagestrategie beachten.
Investieren sie nämlich zu stark in illiquide Anlagen wie Immobilien oder Private Equity, könnte es zu Engpässen bei den Auszahlungen kommen.
Unterdeckung als Problem
Doch Pensionskassen freuen sich über den Wegfall des Langlebigkeitsrisikos teils auch zu früh, weil sich die Situation etwa bei einer allfälligen Unterdeckung verschlimmert.
Die Kapitalauszahlung verstärke zusätzlich die Unterdeckung, erklärte Ullmann zu den hohen Kapitalabflüssen, da sie zu 100 Prozent erfolgten.
Mit der Pensionierung der Babyboomer könnten solche Aspekte sogar noch zusätzlich an Relevanz gewinnen, hiess es weiter.
Und Unterdeckungen sind in der Schweiz doch recht häufig anzutreffen – gerade wenn die Kapitalmärkte nicht so gut florieren.
Altersarmut vermeiden
Aus gesellschaftspolitischer Sicht könnte ein «exzessiver» Kapitalbezug bei fehlender Eigenverantwortung für die Schweiz sogar künftig zur Armutsfalle werden.
Da 100-prozentiger Kapitalbezug häufig bei unteren Einkommensklassen anzutreffen ist, könnten die Menschen letztlich dem Staat doch zur Last fallen, was eigentlich mit dem Zwangssparen in der 2. Säule verhindert werden soll.
Somit wird die Berufliche Vorsorge letztlich nicht nur zu einer der schwierigsten Denkaufgaben für die Schweizer selbst, sondern auch für den Schweizer Staat.
Der muss um Langlebigkeit, Kapitalbezug, Umwandlungssatz, Rentenleistungen & Co. knifflige Entscheide treffen.
17.11.2025/kut.