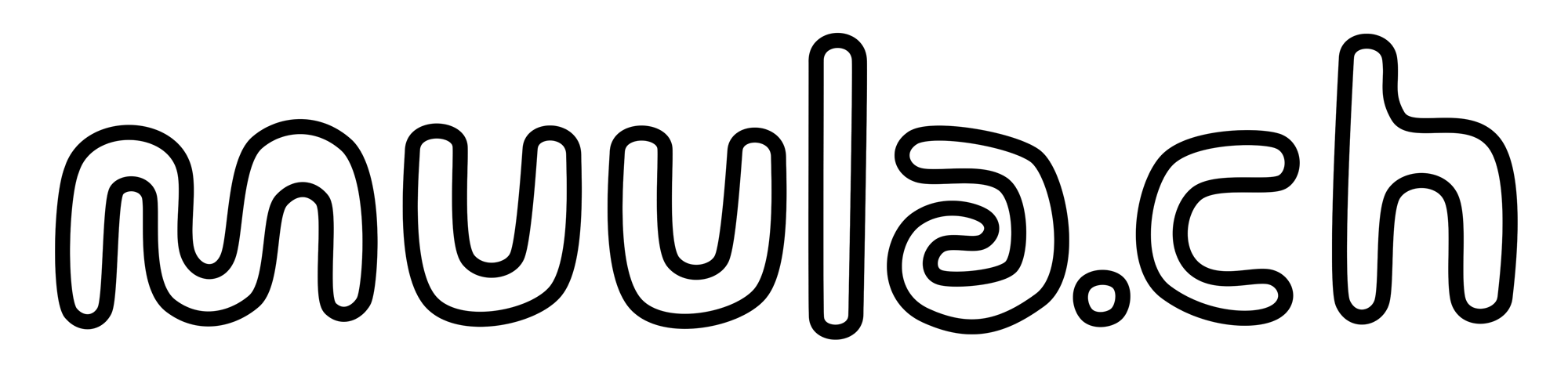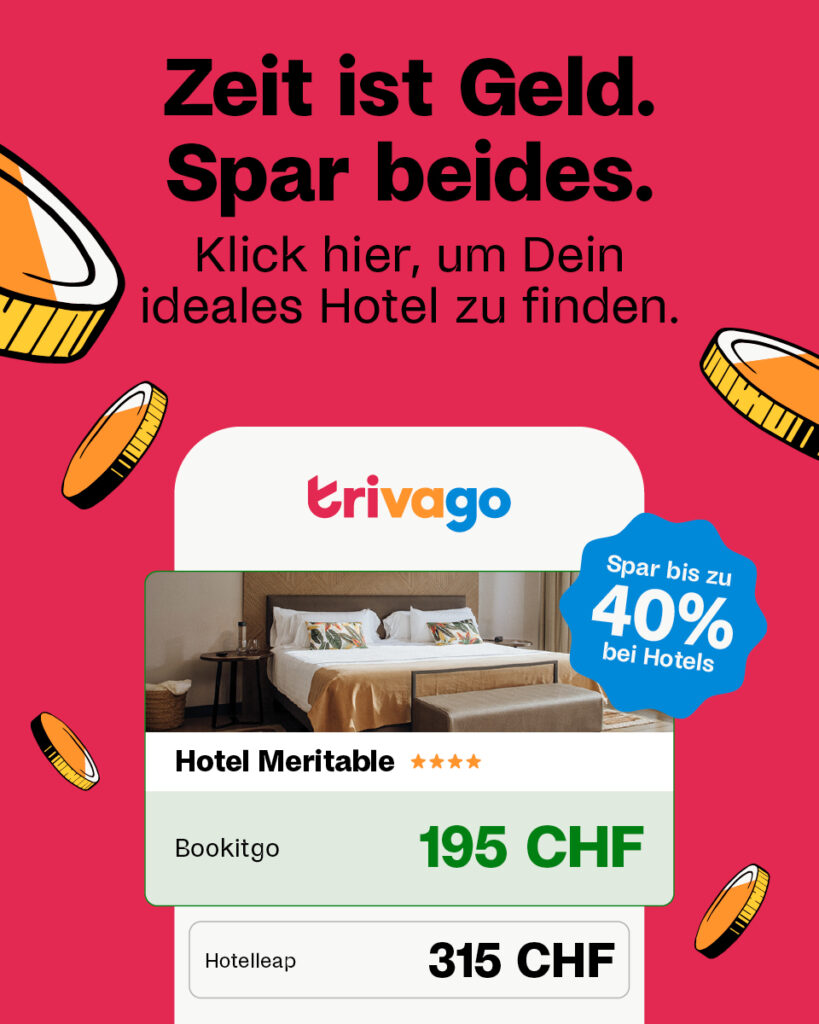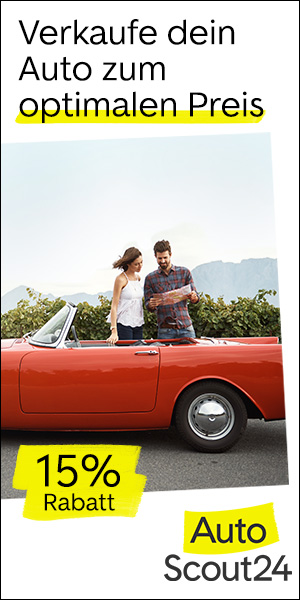Viele Leser baten muula.ch, den Hype um Schweizer Luxusuhren zu erklären. Mit einem Guide zu Rolex, Patek Philippe & Co. kommen wir dem nach.
Schweizer Luxusuhren sind weit mehr als nur präzise Zeitmesser.
Sie sind Ausdruck von Handwerkskunst, Innovationen und ästhetischer Exzellenz.
Gespannte Feder als Energiequelle
Doch darum ist ein Dickicht entstanden, sodass sich Interessierte kaum noch durchfinden.
Das Wirtschaftsnews-Portal muula.ch bringt auf zahlreichen Leserwunsch daher einen Wegweiser durch die Welt der Luxusuhren und zeigt dabei sogar Aspekte, die beim Kauf oder beim Investieren die Hauptkriterien darstellen.
Im Zentrum einer jeden Luxusuhr steht das Uhrwerk. Diese Werke können mechanisch oder quarzbetrieben sein.
Sekundenzeiger bringt Unterschied
Quarz-Uhrwerke nutzen eine Batterie und einen Quarzkristall, um die Zeit zu messen. Sie sind äusserst präzise und wartungsarm. Sie erkennt man direkt am Sekundenzeiger, der ruckartig von einer Zahl zur nächsten springt.
Doch der Hype um Luxusuhren dreht sich um die mechanischen Uhrwerke, die über eine gespannte Feder aus dem Inneren ihre Energie erhalten und bei der eine Vielzahl präzise gefertigter Bauteile perfekt ineinandergreifen. Sie zeigen über mehrstufige Getriebe die Zeit an.
Der Sekundenzeiger gleitet dabei langsam schwebend von einem Wert zum nächsten.
Gangreserve in Stunden
Die Energie für die Feder kann dabei aus zwei Quellen stammen. Einerseits müssen die Besitzer das Uhrwerk manuell aufziehen und die Uhr läuft dann über die kontrolliert abgegebene Energie zwei bis drei Tage lang.
Dabei ist die Rede von Gangreserve und wird in Stunden angegeben.
Andererseits entwickelten viele Uhrenhersteller innovative Automatikwerke, die sich durch die Bewegungen des Trägers ständig selbst aufziehen.
Mit dieser Grobeinteilung, also Quarzuhren und mechanische Zeitmesser, die wiederum automatisch oder handbetrieben sein können, trennt sich schon mal die Spreu vom Weizen.
Uhrenliebhaber schwören nämlich nur auf mechanische Uhrwerke.
Eta, Sellita und Miyota
Doch auch da ist nicht alles gleich. Namhafte Uhrenhersteller entwickeln ihre Uhrwerke selbst.
Andere kaufen sie von Anbietern, wie Eta, Sellita oder etwa Miyota, die aufgrund der grossen Produktionszahlen deutlich günstiger sind.
Manche Hersteller von Luxusuhren helfen sich auch gegenseitig mit Uhrwerken oder sie nutzen Drittanbieter und veredeln diese noch mit ihren eigenen Nuancen.
Uhrensammler bevorzugen aber fast nur Marken, die ihre eigenen Uhrwerke verwenden. Damit scheiden bereits viele Hersteller von Anfang an als Sammlerobjekte aus.
Kombinationen möglich
Anhand der Uhrwerke kann man bereits erkennen, dass es zwei grosse Regionen von Uhrmacherkunst gibt.
Das ist einerseits die Schweiz, die als das Epizentrum der Luxusuhrenindustrie gilt und wo ETA- sowie Sellita-Uhrwerke gefertigt werden.
Daneben haben sich aber auch japanische Uhrenhersteller durch die Kombination traditioneller Uhrmacherkunst mit moderner Technologie, wie Miyota, etabliert.
Diese Produzenten von Uhrwerken gehören nicht selten zu Grosskonzernen.
So ist ETA ein Teil der Swatch-Gruppe und Miyota ist eine Tochterfirma von Citizen Watch aus der gleichnamigen Stadt Miyota in der Präfektur Nagano.
Cartier, IWC und Panerei
Damit wären Interessenten an Luxusuhren auch bereits bei den Konzernzugehörigkeiten. Diese verschaffen einzelnen Marken den Zugang zu Ressourcen und globalen Vertriebsnetzen. In der Schweiz dominieren die Swatch-Gruppe sowie der Richemont-Konzern den Markt.
Weltweit kommen noch der Luxusgüterkonzern LVMH sowie Kering dazu. In Japan gibt es neben Citizen noch die Seiko-Gruppe.
Diese Konzerne haben viele Marken für die unterschiedlichen Kundengruppen im Portfolio.
Swatch deckt praktisch die gesamte Nachfragebreite mit Tissot und Longines von eher günstig bis ganz nobel um Omega, Harry Winston, Breguet sowie Blancpain ab.
Familien besitzen die Firmen
Bei Richemont sind berühmte Luxusuhrenmarken Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne oder Officine Panerai. Diese sind alle im gehobenen Segment.
Bei LVMH existieren TAG Heuer, Hublot und Zenith.
Neben diesen Konzerngesellschaften gibt es zahlreiche unabhängige Uhrenhersteller. Die berühmtesten sind wohl Patek Philippe, Audemars Piguet und Rolex.

Diese befinden sich entweder in Familienbesitz oder zu einer Stiftung.
Zahlreiche weitere Uhrenhersteller, wie H. Moser & Cie., Richard Mille, Jacob & Co., Ulysse Nardin, Girard-Perregaux beziehungsweise Oris, sind in den Händen von Privatpersonen.
Luxusmarken springen auf
Manche Liebhaber von Zeitmessern setzen bei ihren Sammlungen ausschliesslich auf unabhängige Uhrenmarken. Insofern haben da Konzerngesellschaften das Nachsehen, egal was sie auf den Markt bringen.
Zudem springen andere Luxusdesignermarken um Gucci, Dior, Bulgari, Louis Vuitton, Hermes & Co. auf Produkte aus der Uhrenwelt auf, die aber meist nur in Lizenz gefertigt werden und damit oftmals keine Sammlerwerte darstellen.
Saphirglas überzeugt
Da wären Interessierte bereits bei den Produkten. Die Uhrenindustrie kennt drei Haupttypen an Gläsern.
Acrylglas ist zwar leicht und kostengünstig. Es ist aber sehr anfällig für Kratzer. Daher kommt es nur im unteren Preissegment, wenn überhaupt, zum Einsatz.
Dann gibt es noch Mineralglas. Es ist härter und widerstandsfähiger gegen Kratzer.
Das Topniveau liefert aber Saphirglas, welches extrem kratzfest und langlebig ist, fast ausschlieslich in Luxusuhren eingebaut wird.
Viele Spielereien
Neben der Uhrzeit setzen Uhrenhersteller auf immer mehr Raffinesse, je nach Zielgruppe. So waren Piloten vor Jahrzehnten von mechanischen Uhren angetan, weil sie zwei Zeitzonen anzeigen konnten.
Zu den Zusatzfunktionen, die eine Uhr über die einfache Zeitmessung hinaus bieten, häufig als Komplikationen bezeichnet, gehören etwa Chronographen, die mittels Stoppuhrenfunktionen gewisse Zeitintervalle messen können.

Daneben gibt es ewige Kalender, also die Anzeigen von Datum, Tag, Monat und Jahr unter Berücksichtigung von Schaltjahren. Der Raffinesse sind kaum Grenzen gesetzt.
Als Tourbillons werden Mechanismen bezeichnet, die den Einfluss der Schwerkraft auf die Ganggenauigkeit minimieren.
Und unter Minutenrepetitionen verstehen Experten die Funktionen, die die Zeit durch akustische Signale anzeigen.
Wasserdicht und wasserabweisend
Je mehr «Spielereien» an einer Luxusuhr zu finden sind, desto mehr Begeisterung entsteht bei der Fangemeinde.
Hinzu kommen Wasserdichtigkeit, um sie beim Schwimmen oder Tauchen tragen zu können, oder Armbänder aus Leder, Kautschuk, Nylon beziehungsweise Metall, die verschiedene Design- und Komfortmerkmale bieten.
Leder geht bei Taucheruhren logischerweise nicht.
Rubine im Uhrwerk
Für gewisse Liebhaber, wie etwa Araber, müssen Luxusuhren gross und aus Edelmetallen, wie Gold oder Platin sein, um als Statussymbol genügend Geltung zu verschaffen.
Die Uhrenhersteller fertigen die Edelticker auch mit Edelsteinen um Diamanten & Co.
Davon zu unterscheiden ist allerdings das Innere, denn Rubine kommen als sogenannte Lagersteine im Uhrwerk zum Einsatz, weil diese sehr hart sind und damit perfekt in mechanischen Uhren die Bewegungen abfedern können, ohne zu verschleissen.
Je mehr Komplikationen in einem Zeitmesser enthalten sind, desto mehr stabilisierende Rubine beziehungsweise Edelsteine braucht es.
Extravagante Zifferblätter und Lünetten
Die Hersteller von Schweizer Luxusuhren spielen nun auf der ganzen Länge die Kombinationen aus. Vollgold-Versionen wechseln sich mit Wiederauflagen von Modellen ab, die Jahrzehnte nicht produziert worden waren.
Mal ist die Krone, also das Rad zum Einstellen und Aufziehen, auf vier statt auf drei Uhr oder sogar auf der anderen Seite. Mal sind die Uhren protzig für Topmanager, mal sind sie fein für dünne Handgelenke.
Mal ist das Zifferblatt exklusiv, mal ist die Lünette, also die Umrandung des Uhrenglases, etwas Besonderes.
Nachfrage grösser als Angebot
Dabei achten die Produzenten peinlichst darauf, dass die Nachfrage stets grösser ist als das Angebot, damit die Verkaufspreise nicht in den Keller rauschen. Interessente lassen sie oftmals zappeln, produzieren nur limitierte Auflagen oder bieten dem Markt bloss weniger gefragte Modelle an.
Rolex produziert jährlich ja alleine um eine Millionen Stück.
Am liebsten sind den Luxusuhrproduzenten als Käufer aber ernsthafte Sammler, weil deren Uhren in der Regel nicht auf Zweitmärkten landen und quasi von der Bildfläche verschwinden.
Frankenstein-Uhren erkennen
Gerade auf Zweitmärkten tummeln sich aber viele Scharlatane, die entweder vollständige Fälschungen oder Mischuhren verkaufen, die aus Original- und Falschteilen zusammengebaut wurden, und die als Frankenstein-Uhren bezeichnet werden.
Fälscherbanden basteln da quasi aus einer Rolex mehrere Unechte, deren Authentizität nur sehr schwer festzustellen ist.
Kombination aus Erkennungszeichen
Die Luxusuhrenhersteller müssen sich daher immer mehr Merkmale überlegen, wie sie ihre Originalhandwerksstücke identifizieren können, denn die Fälscherindustrie schläft auch nicht.
Es gibt aber nicht «das» Erkennungszeichen, sondern meist ist es der Gesamteindruck aus Verarbeitung, Präzession & Co.
Das ist aber auch der Grund, warum Sammler präferieren, jahre- oder manchmal sogar jahrzehntelang auf eine Luxusuhr vom Produzenten zu warten.
Dann, und nur dann, können Uhrenfans zu 100 Prozent sicher sein, dass es sich in der komplexen Welt der Luxusuhren auch tatsächlich um ein Original der Schweizer Uhrmacherkunst handelt.
16.06.2024/kut.