
Die Coronavirus-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, wie sich die Uneinigkeit von Virologen auswirken kann. Nun streiten Ökonomen und dies könnte fatal für die Schweiz sein.
Streit unter Wissenschaftern in der Öffentlichkeit ist nie gut. Wenn die Schweiz etwas aus der Coronavirus-Pandemie gelernt hat, dann dies: Unterschiedliche Ansichten von Experten über den Nutzen von Schutzmasken oder die Wirkungen von Impfungen sind nicht unbedingt richtig oder falsch.
Sie können aber grosse Verunsicherung sowie Fehlentwicklungen auslösen.
Steuern für Reiche?
So gibt es derzeit weltweit eine Diskussion, die jüngsten Ausgabenpakete des Staates sowie Hilfsmassnahmen für die Energiekrise einfach den Reichen über höhere Steuern in Rechnung zu stellen. Dies, so die Logik, wäre die beste Lösung für alle.
In Deutschland ging der Streit nun sogar so weit, dass die Wirtschaftsweisen, also das höchste Beratergremium der deutschen Regierung, Steuererhöhungen für die Ultra-Reichen empfiehlt. Eine Teilfinanzierung durch eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder einen Energie-Solidaritätszuschlag für Besserverdienende, hiess es im Sachverständigen-Gutachten.
Sofort wurde aber Kritik laut, die Massnahme würde völlig am Ziel vorbeischiessen.
Gegenrede von Professoren
«Man muss schon einen sehr guten Grund haben, wenn man mitten in der Krise Einkommensteuern erhöhen will», sagte der Präsident des Münchener ifo-Instituts, Clemens Fuest, im Interview mit «Welt TV». Das ist immerhin auch ein bekannter Wirtschaftsprofessor.
Um die Staatsfinanzen zu konsolidieren, sei dies der falsche Weg. «Man könnte auch Ausgaben abbauen, um Schulden zu bedienen», so Fuest weiter.
Ewige Abgaben
Ähnlich argumentiert Michael Hüther, der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Ein temporärer Zuschlag zur Einkommensteuer oder eine befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes erscheine «politisch naiv, wie das Beispiel des ewigen Soli zeigt», so Hüther.
Die Bereinigung der kalten Progression verschieben zu wollen, bedeute die Hinnahme einer nicht legitimierten Steuererhöhung, sagte der IW-Chef.
Er sprach damit die Umstände an, dass es den Solidaritätszuschlag zur Finanzierung der deutschen Wiedervereinigung auch Jahrzehnte später im «Grossen Kanton im Norden» immer noch gibt und mit der steigenden Inflation der Staat automatisch mehr Steuern einnimmt.
Rechtfertigung der Aktion
Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier verteidigte aber umgehend wieder die Vorschläge des Sachverständigenrates zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, einen Solidaritätszuschlag einzuführen oder den Spitzensteuersatz zu erhöhen, um die Folgen der Energiekrise zu finanzieren.
«Wir sollten nicht immer mehr Geld aufnehmen und in die Wirtschaft pumpen, ohne zu wissen, wo es herkommt», sagte die Ökonomin zur Zeitung «Welt». «Die Finanzierungsmöglichkeiten werden nie für alle toll klingen, es wird immer eine Gruppe geben, die sie nicht gut findet.»
Andere Vorschläge, wie sich die höheren Ausgaben finanzieren lassen könnten, hätten es nicht in das Jahresgutachten geschafft, weil die Wirtschaftsweisen keine gemeinsame Position dazu gefunden hätten.
Mahnendes Beispiel
Auch in der Schweiz kommt regelmässig die Idee zum Vorschein, dieses Konzept mit dem Schröpfen der Reichen etwa zum Abbau der Coronavirus-Hilfspakete zu nehmen oder Gewinne von Energiefirmen speziell abzuschöpfen.
Eindrücklich zeigen sich derzeit die Auswirkungen solcher Massnahmen in Kolumbien und dies sollte eine Warnung für die Schweiz sein. Der erste linke Präsident des südamerikanischen Landes, Gustavo Petro, braucht dringend Geld, um seine ganzen Wahlversprechen an die Unterschicht zu finanzieren. Soeben beschloss daher seine Regierung, umgerechnet rund vier Milliarden Franken an Mehreinnahmen über Steuererhöhungen für Erdöl-, Kohle-, sowie Goldminien-Firmen zu generieren.
Zudem will das Land künftig Reiche, die für dortige Verhältnisse ein hohes Monatseinkommen ab 2000 Franken erzielen, mit einer Zusatzsteuer von 2 Prozent belasten. Dies geschah, nachdem der Vorschlag, die Steuerfreiheit der katholischen Kirche aufzuheben, erfolgreich weg-lobbyiert worden war.
Einbruch der Währung
Gegenüber dem Dollar ist die Landeswährung, der kolumbianische Peso, seit der Machtergreifung Petros aber mittlerweile um rund 20 Prozent eingebrochen. Die Abnehmer der kolumbianischen Exportschlager, Erdöl und Kohle, sehen sich bereits nach anderen Lieferanten um. Die Inflation ist offiziell auf über zehn Prozent hochgeschnellt.
Vielen Kolumbianern lief es daher vergangene Woche kalt den Rücken runter, als sich ihr neuer Präsident Petro mit Nicolás Maduro, dem Präsidenten Venezuelas, in Caracas hat zur Schau gestellt.
Leuthard und Maduro
Bald werden die Kolumbianer vielleicht auch wie die Einwohner des Nachbarlandes unter Hyperinflation leiden und nichts Gescheites mehr zum Essen haben, so die Angst vielerorts, wie Recherchen von muula.ch ergaben.
Und auch in der Schweiz gab es vor noch nicht allzu langer Zeit so einen Moment, der bei Betrachtern das Herz fast zum Stillstand gebracht hatte. Dies war, als die damalige Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard den sozialistischen Präsidenten Boliviens, Evo Morales, in der Schweiz hofierte.
So weit ist der Streit unter Ökonomen um das richtige Konzept also gar nicht von der Schweiz entfernt.
11.11.2022/kut.
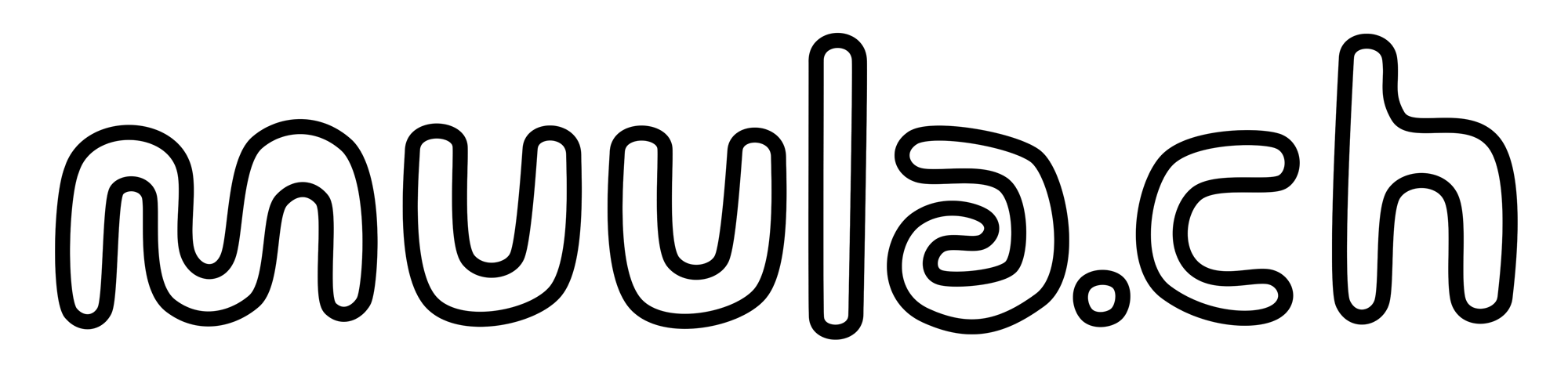
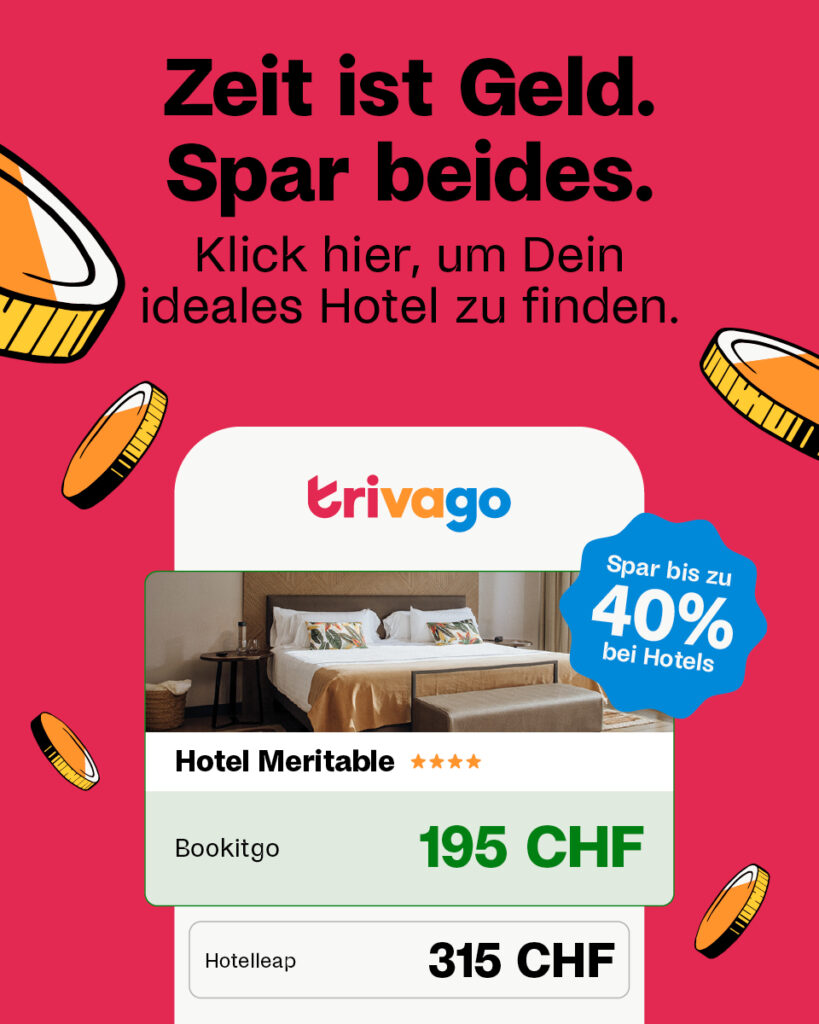



Die reiche Schweiz mit Kolumbien zu vergleichen ist absurd. Ein Wahlversprechen von Petro ist z.B. kostenlose Bildung, in der Schweiz eine Selbstverständlichkeit. Da bis jetzt die reiche Elite regiert hat die soche Volksanliegen wenig gekümmert hat, braucht es dazu neue Einnahmen die nur von den begüterten gestemmt werden können. Was die Währung betrifft, es wäre nicht die erste volksnahe Regierung die mit Finanzmanipulationen abgestraft würde. Da ist Kolumbien eben nicht die reiche Schweiz.