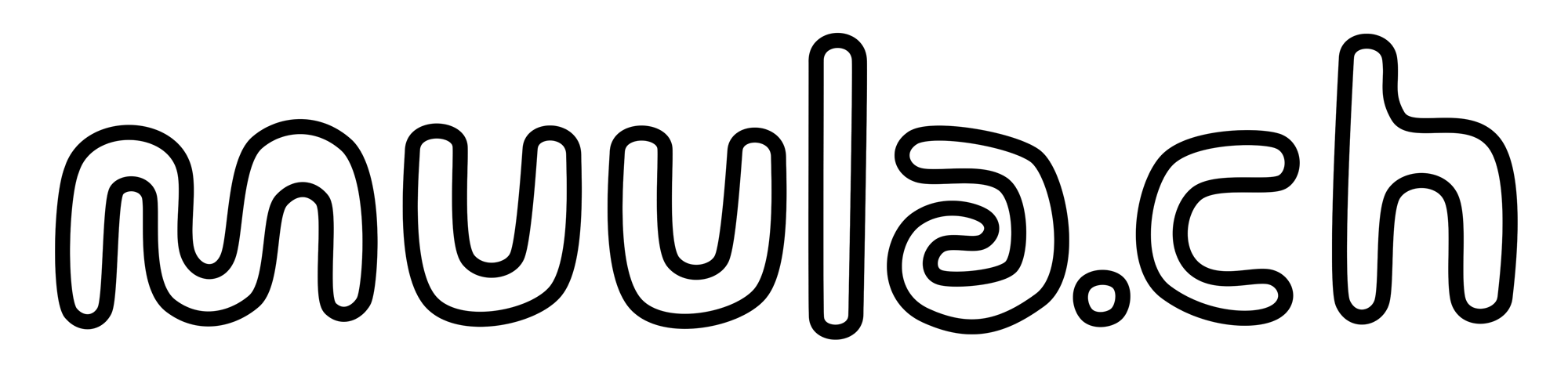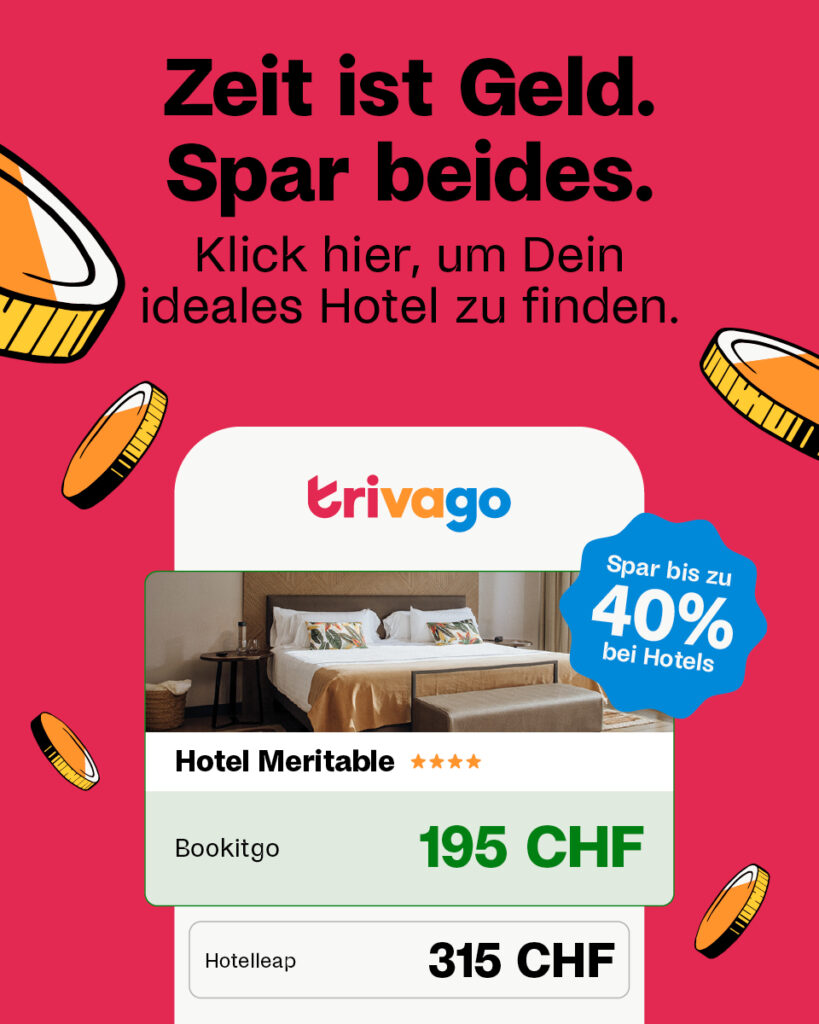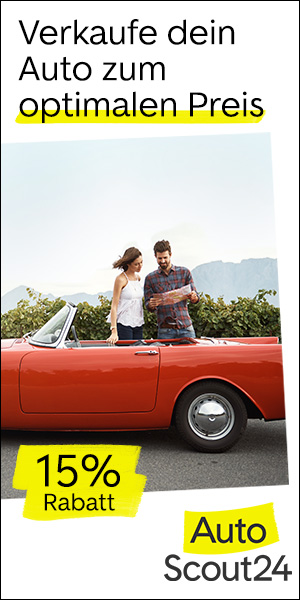Die Schweiz wollte die Bezeichnung «Schweiz» und das Schweizerkreuz in einer globalisierten Welt schützen. Doch dies wird zum Hemmschuh mit den USA.
Schweizer Produkte und Dienstleistungen geniessen sowohl im In- als auch im Ausland einen hervorragenden Ruf hinsichtlich der von ihnen vermittelten Werte wie Exklusivität, Tradition und Qualität.
Milliarden an Wert
Dank dieses von Konsumenten hoch geschätzten guten Rufs liessen sich mit der Schweiz in Verbindung gebrachte Produkte und Dienstleistungen in einem höheren Preissegment positionieren, hiess es einst zur Lancierung der umstrittenen Swissness-Gesetzesvorlage.
Der «Swissness-Mehrwert» würde bis zu 20 Prozent des Verkaufspreises ausmachen und Uhren sowie Schmuck, Käse und auch Schokolade profitierten davon substanziell.
Zusammen mit der Maschinenindustrie bezifferte die Schweiz diesen Mehrwert auf rund 5,8 Milliarden Franken.
Behinderung flexibler Produktion
Die Schweiz wollte daher «Made in Switzerland» schützen und missbräuchliche Verwendungen im In- und Ausland unterbinden.
Doch seit US-Präsident Donald Trump über die Schweiz einen US-Strafzoll von 39 Prozent verhängt hat, fallen vielerorts die Limitierungen der sogenannten Swissnes-Vorlage für die eigene Volkswirtschaft auf.
Viele Firmen, wie Schoggi- und Uhrenhersteller, können nicht flexibel Teile der Produktion in die USA verlagern.
Rund 60 Prozent der Wertschöpfung sowie der Hauptherstellungsschritt müssen laut Gesetz in der Schweiz erfolgen, andernfalls verstossen Anbieter gegen Schweizer Recht.
Von On-Laufschuhen bis Kaffee
Was schon in der Vernehmlassung ein Problem war, wird nun noch deutlicher. Klar wachsen in der Schweiz keine Kaffee- und Kakaobohnen, weshalb der Nahrungsmittelriese Nestlé mit Nespresso und Nescafé grosse Schwierigkeiten hatte, die Swissness seiner bekannten Produkte zu erfüllen.
Auch bei Schokoladeherstellern wie Lindt & Sprüngli und Frey wird der Unsinn klar. Wie gross ist die Schweizer Wertschöpfung, wenn eine Hauptzutat gar nicht aus der Schweiz stammt? Da können Bürokraten jahrelang philosophieren. Den Firmen nützt all dies nichts.
Zuletzt war dies beim Sportschuhhersteller On von Tennisstar Roger Federer zum Vorschein gekommen, weil an einigen Produkten ausserhalb des Landes das Schweizerkreuz prangert, obwohl die Laufschuhe in Asien hergestellt werden.
Schweizer Botschaften als Detektive
Den Wert der «Marke Schweiz» sicherte das Land dann mit komplizierten Regelungen über viele Ecken.
Mittlerweile ist die Sicherung zum komplexen Bürokratiemonster verkommen, denn Schweizer Diplomaten gehen auf der ganzen Welt durch Lagengeschäfte und suchen nach Sündern.
Danach klagt die Schweiz lokal mit dubiosen Methoden, um Schweizer Recht auch im Ausland durchzusetzen.
Kreative Berechnungsmethoden unter Ausklammerung von in der Schweiz nicht erhältlichen Rohwaren bestimmen mittlerweile das Geschehen.
Schweizer Käse mit Auslandsmilch
Lebensmittel um Schweizer Käse, Schoggi und Kakao sollten laut Wirtschaftsverbänden ohnehin von dem ganzen Quatsch um komplizierten Markenschutz bei extrem schwankenden Rohstoffpreisen ausgenommen werden.
Doch Mit ausländischer Milch hätte dann auch «Schweizer Käse» hergestellt werden können, was der Bundesrat nicht wollte.
Der Chipshersteller Zweifel holt sogar Kartoffeln von jenseits der Landesgrenzen, wenn die Schweizer Ernten schlecht ausfallen. Auch ausländisches Sonnenblumenöl kam schon beim Frittieren zum Einsatz. Auch da ist stets die Hauptwertschöpfung «Swiss made» tangiert. Wie viel? Wer weiss.
Letztlich spricht die Qualität Schweizer Waren doch eine eigene Sprache. Jeder Kunde merkt, wenn eine Schweizer Luxusuhr um Patek Philippe, Rolex & Co. nicht dem hohen Qualitätsanspruch des Landes entspricht.
Augenhöhe verloren
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin wollen am heutigen Mittwoch in Washington versuchen, mit einem verbesserten Angebot der Schweiz, den US-Präsidenten Trump umzustimmen, um die Strafzölle von 39 Prozent noch abzuwenden.
Wie verfahren die Situation ist, zeigt, dass sich Trump über Bundespräsidentin Keller-Sutter sogar öffentlich lustig macht und die FDP-Bundesrätin am heutigen Mittwoch wohl nur vom US-Aussenminister Marco Rubio empfangen wird.
Da stimmen nicht einmal Ranghöhe und Dossierkompetenz. Keller-Sutter gehört eigentlich auf Augenhöhe ins Weisse Haus.
Zu grosse Abhängigkeit von Uncle Sam
Doch letztlich zeigt sich, dass der globale Trend, stets lokal zu produzieren und auch dort auszuliefern, an die Grenzen Schweizer Gesetze stösst.
Keller-Sutter und Parmelin müssten eigentlich erst zu Hause in limitierenden Gesetzen aufräumen, bevor sie neue Angebote an die USA machen.
Und die Abhängigkeit der Schweiz von den USA um Kampfjets F-35, die Pharmaindustrie von Roche und Novartis, die Milliarden-Dollar-Anlagen bei der Schweizerischen Nationalbank SNB, die Administration des Sozialwerkes AHV von Amerikanern und und und, ist ohnehin viel zu gross.
Keller-Sutter und Parmelin sollten da lieber nach Peking fliegen.
06.08.2025/kut./Angaben zu Zweifel nach Hinweisen der Firma angepasst