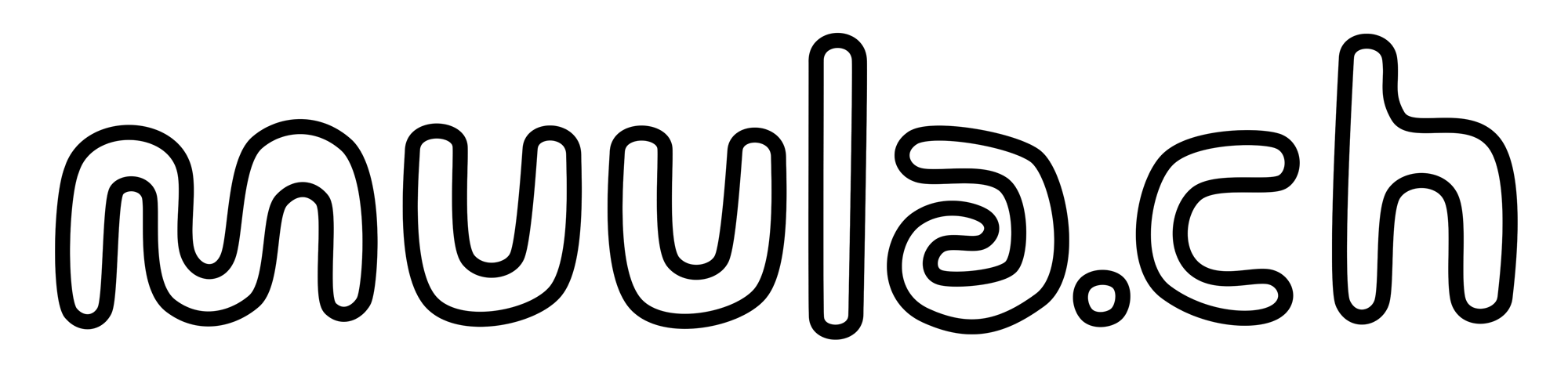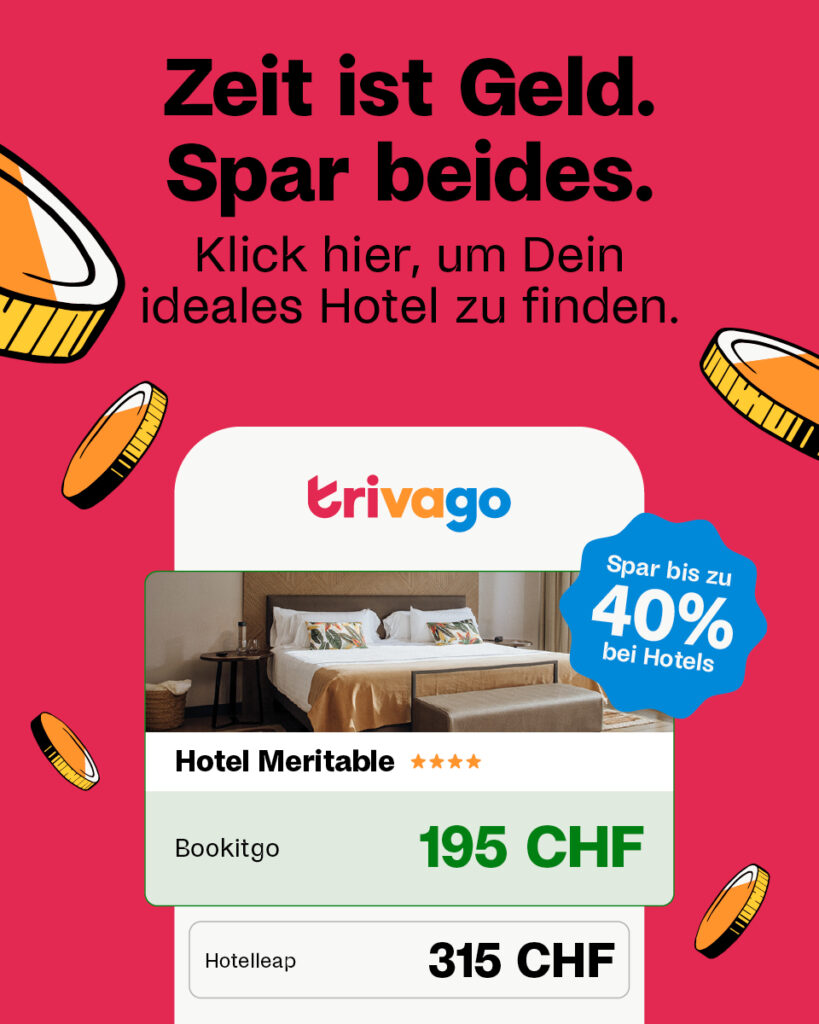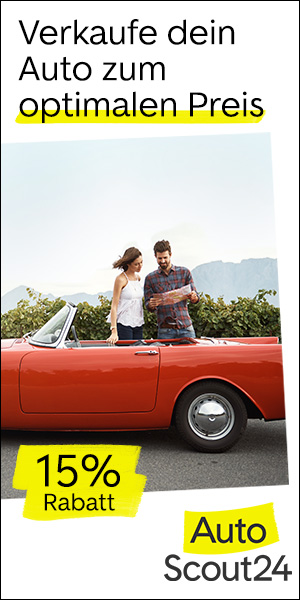Die Schweiz und die EU paraphieren schon bald die Vertragstexte ihres Verhandlungspakets. Doch inhaltlich zerfällt das ganze Vorhaben zusehends.
Am nächsten Mittwoch wollen die Schweiz und die Europäische Union (EU) ihre bilateralen Beziehungen auf neue Beine stellen.
In Bern wollen die Vertragsparteien laut offiziellen Angaben die Texte der Verhandlungen paraphieren, die Ende vergangenes Jahr abgeschlossen worden waren.
Geheimnisse um Inhalt
Das Volk und viele Politiker wissen nicht, worauf sich die Schweiz da genau einlässt. Das Eidgenössische Aussendepartement EDA und das Bundesamt für Justiz (BA) gewähren nur scheibchenweise Einblick in die Verträge.
Insider dürfen sich aufgrund von Geheimhaltungserklärungen zum Inhalt der rund 1800 Seiten nicht äussern, wie muula.ch über das Theater berichtete.
Neues Instrument gefunden
Zwischenzeitlich preisen Bundesräte einige Details vor den Medien und versuchen, das Volk damit zu beruhigen.
Justizminister Beat Jans (SP) stellte am heutigen Mittwoch in Bern eine Schutzklausel vor, welche die Schweiz aktivieren könnte, falls ihr die Zuwanderung aus der EU zu bunt werde.
«Wir geben uns ein griffiges Instrument in die Hand, ohne dass wir den bilateralen Weg gefährden», lobte er das Verhandlungsresultat vor den Medien.
Der Gesamtbundesrat legte gleichentags fest, aufgrund welcher Schwellenwerte und Indikatoren die Schweiz künftig die Zuwanderung einschränken darf.
Vier relative Entwicklungen
Der Bundesrat muss die Aktivierung der Schutzklausel prüfen, falls bei einem der vier Indikatoren ein landesweiter Schwellenwert überschritten ist.
Es seien die Nettozuwanderung aus der EU, die Zahl der neuen Grenzgänger, die Zunahme der Arbeitslosigkeit und die Sozialhilfequote, hiess es in einem Merkblatt.
Die Schwellenwerte seien relativ, hiess es aus Bundesbern. Die Schweiz vergleiche ihre Situation bei der Zuwanderung also mit Veränderungsraten.
Viele Zwischenschritte
Will die Schweiz dann zur Schutzklausel greifen, muss sie dies aber dem Gemischten Ausschuss Schweiz-EU mitteilen.
Gibt es dort keine Einigung, geht es zum Schiedsgericht, was dann prüft, ob die Schweiz die Personenfreizügigkeit mit der EU einschränken darf.

Führt dies zu einem Ungleichgewicht, kann die EU verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen treffen, aber nur im Zusammenhang mit dem freien Personenverkehr.
Wohlgemerkt muss der Bundesrat das Ganze auch wollen.
Guilletine-Klausel entfällt
Ein solcher Mechanismus dürfte beim Volk kaum ankommen, auch wenn sich Jans viel Mühe bei der Vorstellung gegeben hat.
Alles sei besser als die derzeitige Situation, denn mit dem Einschränken der Personenfreizügigkeit fiele auch der EU-Binnenmarktzugang weg.
Das wäre künftig nicht mehr so.
Regulierte Preise möglich
Gleichzeitig trat auch noch Energieminister Albert Rösti (SVP) vor die Medien und erläuterte das Stromabkommen. Die Schweiz braucht eigentlich genau im gleichen Moment vom Ausland notmässig Stromlieferungen.
Da ist es unklar, wie die EU gezwungen werden könnte, der Schweiz die vertraglich zugesicherte Hilfe auch tatsächlich zu gewähren. Wer in die Vernehmlassung zum Verhandlungsmandat schaut, sieht, dass die Schweiz auf keinen Fall eine Strommarktliberalisierung will.
Kantone und der Bund ziehen die Verbraucher also künftig weiterhin über den Tisch.
Im Stromabkommen sei explizit festgehalten, dass die Schweiz im Sinne des Konsumentenschutzes und des Service Public, eine Grundversorgung mit regulierten Preisen für Haushalte und Unternehmen unterhalb einer gewissen Verbrauchsschwelle einführen dürfte.
Der Nutzen von alldem erschliesst sich nur mässig.
Geheimverhandlungen geführt
Gleichzeitig aktivierte Rösti am heutigen Mittwoch neue Stromreserven ab dem Jahr 2026.
Fünf Reservekraftwerke würden in den drei Kantonen Wallis, Aargau und Basel-Landschaft auf Kosten der Verbraucher gebaut, hiess es aus Geheimverhandlungen.
Eine Ausschreibung sei nicht zielführend gewesen.
Lücke in drei Wintern
Die Reservekraftwerke sollen teils mit Pflanzenölen betrieben werden – damit der Schweiz der Strom nicht ausgeht.
Der staatliche Stromkonzern Axpo freute sich umgehend in einer Medienmitteilung, dass er in Muttenz BL die grösste CO2-Notstromvorsorge für Mangellagen schaffen dürfe. Das Reservekraftwerk werde potenziell ab Winter 2029/30 zur Verfügung stehen.
Was bis dahin passiert, steht in den Sternen. Eine Übergangslösung sei für mindestens drei Winter notwendig, und das Rösti-Departement arbeite an einer Lösung.
Schwere Abwägung
Es geht einfach auch beim Strom nichts auf. Letztlich sind zu viele Details im EU-Vertragspaket enthalten.
Das Abwägen zwischen positiven und negativen dürfte bei so vielen Bruchstücken sehr schwerfallen.
Das Volk muss über vier Vorlagen abstimmen – eine ist der Stabilisierungsteil und drei sind die Erweiterungen um Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
14.05.2025/kut.