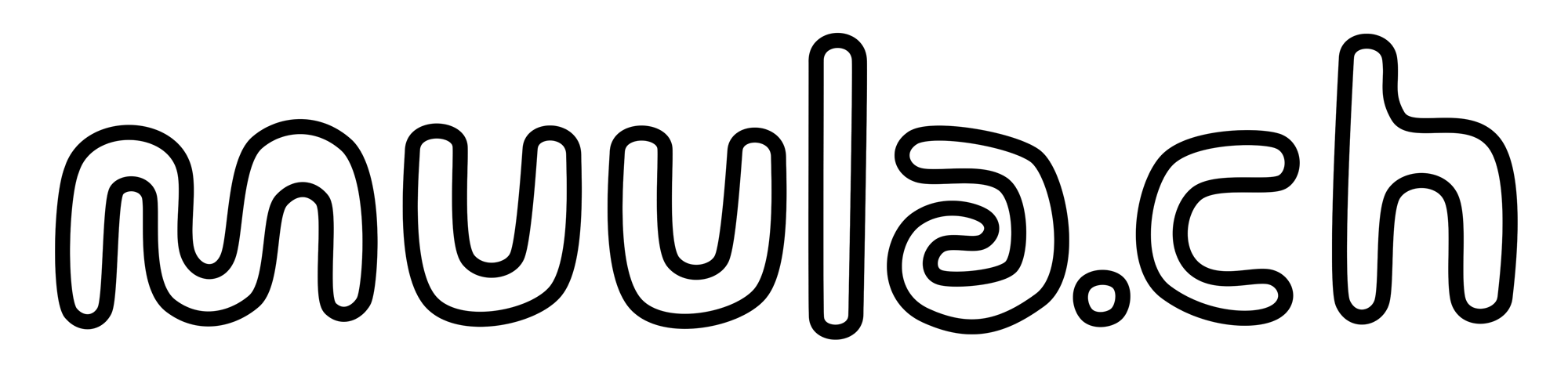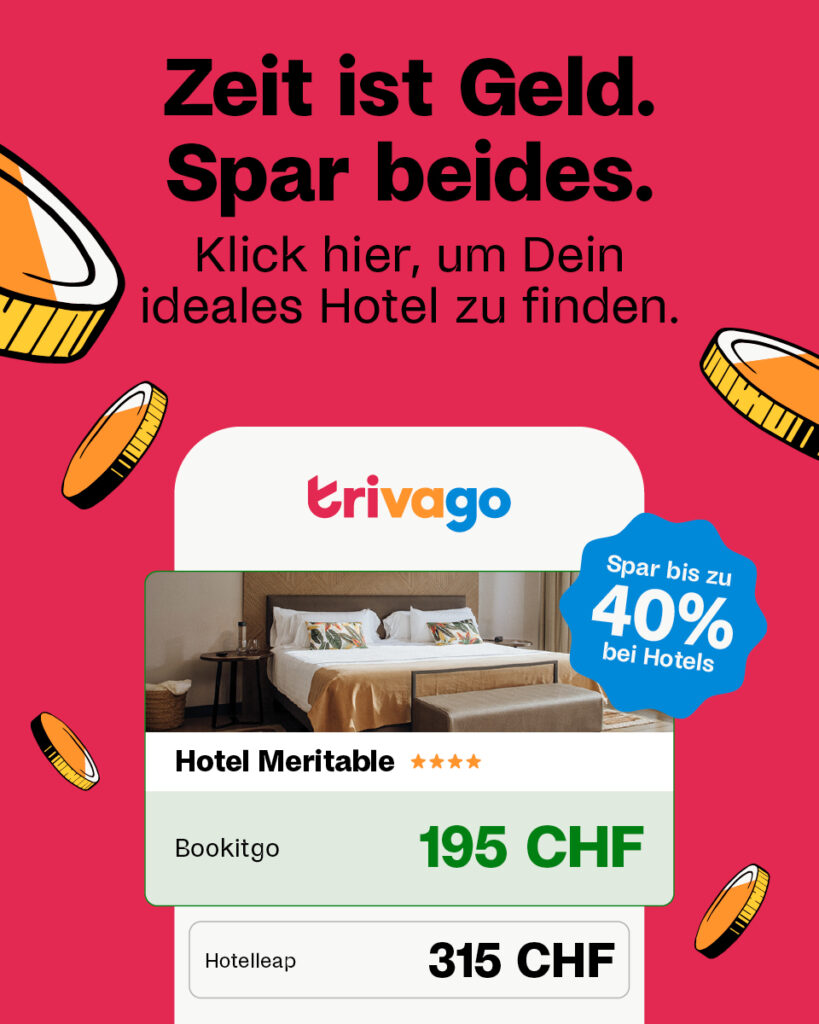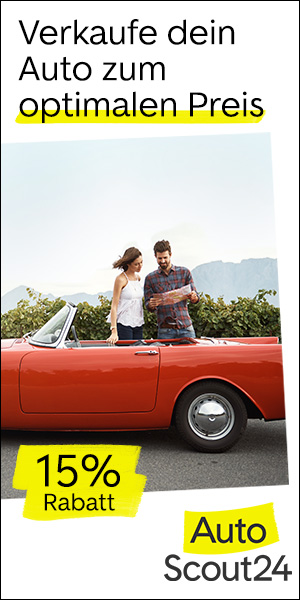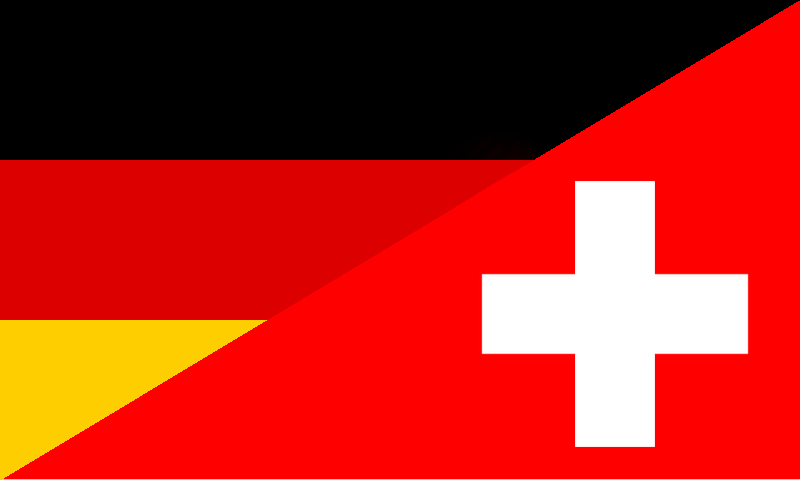
Die Schweiz und Deutschland wollen ihre Grenze neuregeln. Die Behörden entledigen sich dabei Pflichten, und etwas mehr Brüssel kommt nach Bern.
Der Bundesrat hat eine brisante Vernehmlassung eröffnet.
Die Landesregierung will laut Eigenwerbung eine effizientere und zeitgemässe Verwaltung der gemeinsamen Grenze mit Deutschland von Konstanz bis Basel.
Moderne Koordinatensysteme nutzen
Der neue Staatsvertrag solle die in den zahlreichen bestehenden Verträgen enthaltenen Bestimmungen über die Staatsgrenze ersetzen, die teils über 100 Jahre alt sind.
Zudem sehe die Vereinbarung die Einrichtung einer Grenzkommission vor, hiess es vom Bundesrat zur Vernehmlassung nüchtern.
Der Abschluss eines neuen und einheitlichen Vertrags diene vor allem dazu, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Grenzverlaufs anhand moderner Koordinatendaten zu verbessern, erklärte Bundesbern.
Widerspruch in sich
Im abzuschliessenden Vertrag gehe es ausdrücklich nicht um eine Änderung des Grenzverlaufs oder den Austausch von Gebieten zwischen den beiden Staaten, hiess es.
Wer sich jedoch die Details im erläuternden Bericht des Bundesrats anschaut, erfährt, dass dies etwa beim Rhein der Fall ist.
Der dynamische Grenzverlauf in dem Fluss solle einheitlich auf die Mittellinie des Wasserlaufs festgelegt werden, steht dort.
Bisher war an einzelnen Stellen der Talweg des Flusses massgeblich.
Altes Problem bleibt ungelöst
Der Grenzverlauf im Obersee des Bodensees sei zudem vom geplanten Vertrag explizit nicht betroffen.
Warum das zuständige Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS diese Grenzen trotz Modernisierungsbestebungen weiterhin ausschliesst, bleibt ein Behördengeheimnis.
Gerade hier ist in Europa die einzige Gegend, in der zwischen den Nachbarstaaten nie Grenzen festgelegt wurden.
Nur Teile wurden im Jahr 1854 zwischen Baden und der Schweiz sowie im Jahr 1879 zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz bekanntermassen klar aufgeteilt.
Neue Zuständigkeiten festlegen
Doch noch weitere Änderungen, die teils wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten, sollen künftig zwischen Deutschland und der Schweiz gelten.
Das Abkommen soll beispielsweise eine klare und transparente Zuständigkeitsregel für den Unterhalt der vereinbarten Grenzabschnitte einführen.
Im Bericht des Bundesrats wird allerdings klar, dass sich die Behörden auf beiden Seiten der Grenze zahlreichen Verpflichtungen entledigen wollen.
«Diesem Zweck dient insbesondere die Aufhebung der behördlichen Verpflichtung, den gesamten Bereich der Staatsgrenze von Bewuchs oder sonstigen Hindernissen freizuhalten», hiess es wörtlich.
Kontrollen nur alle 24 Jahre
Unter den heutigen politischen und technologischen Bedingungen erscheine es ausreichend und angemessen, die Erkennbarkeit der Grenze im Gelände auf diejenigen Orte zu beschränken, an denen sich die einzelnen Grenzsteine befänden, erklären die Beamten.
Zudem wird das Intervall, in dem die gesamte Grenze durch Begehungen im Gelände vollständig zu überprüfen ist, von sechs auf zwölf Jahre erhöht.
Die Grenzwasserläufe sind künftig regulär sogar nur alle 24 Jahre zu kontrollieren und bei Bedarf zu vermessen.
EU-Richtlinie als Hintergrund
Im Wesentlichen werden mit dem Vertrag, dessen Vernehmlassung noch bis zum Oktober geht, die Erfordernisse der INSPIRE-Richtlinie (2007/2/EG) berücksichtigt.
Diese sieht für EU-Mitgliedstaaten vor, dass neu erhobene Geodatensätze in einer Form bereitzustellen sind, die modernen technischen Standards entspricht.
Die Schweiz ist ebenfalls Mitglied von EuroGeographics und war an der Ausarbeitung der INSPIRE-Richtlinie beteiligt. Diese ist für die Schweiz allerdings nicht verpflichtend.
Doch mit dem neuen Grenzvertrag kommt eben wieder ein Stück Brüssel mehr nach Bern.
29.07.2025/kut.