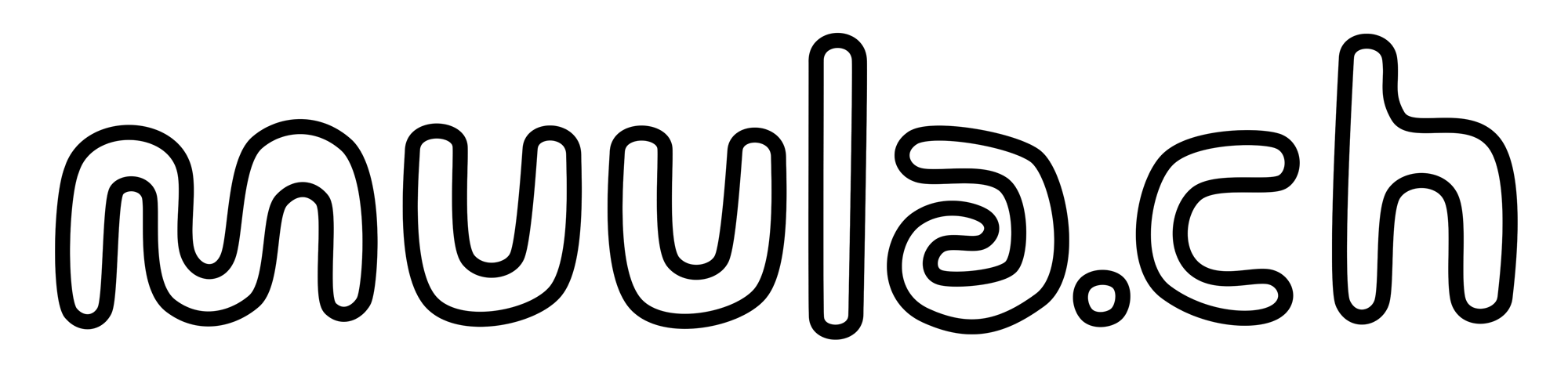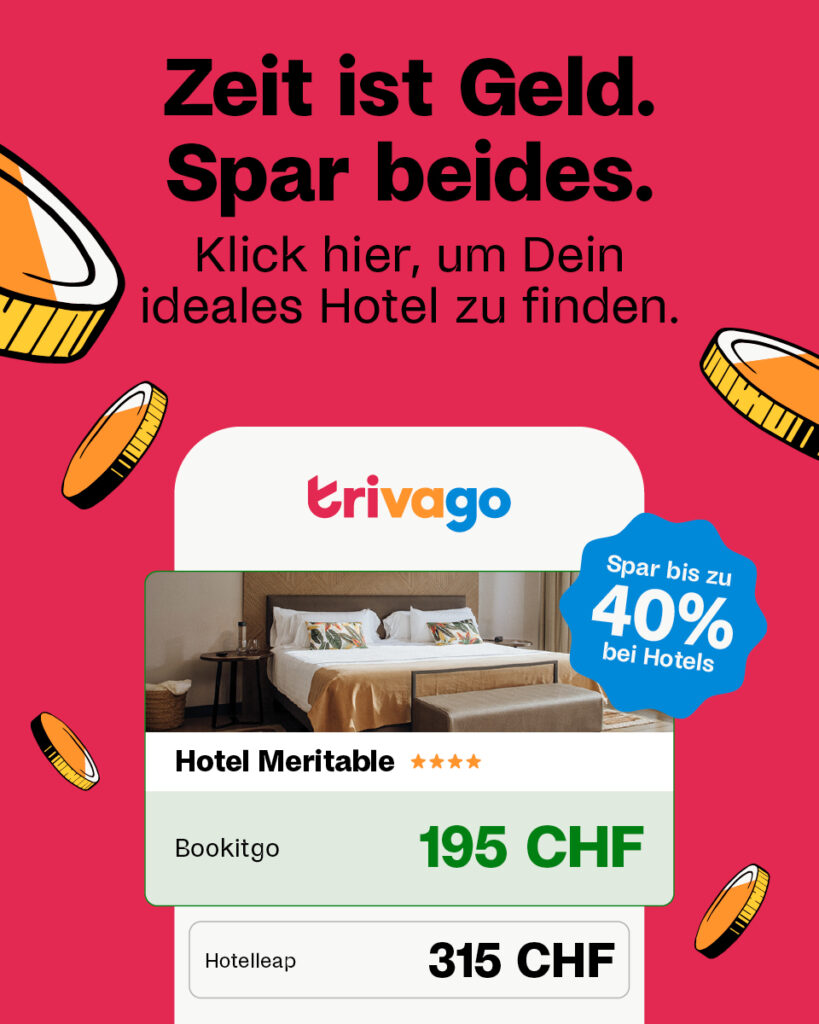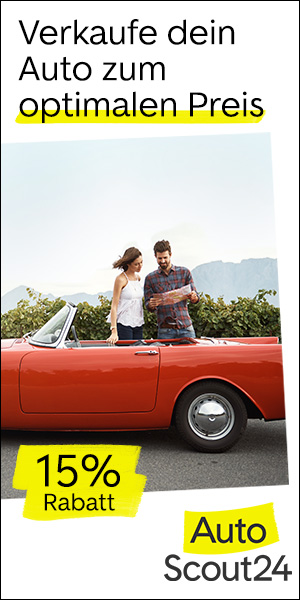Die Schweizer Hotellerie hat sich an eine Unsitte von Subventionen gewöhnt. Diese gehören aber nicht nur wegen klammer Staatskassen abgeschafft.
Wer wirtschaftlich unter Druck gerät, ruft in der Schweiz am besten nach dem Staat.
Das jüngste Beispiel ist nicht einmal die Stahlindustrie, sondern die Schweizer Hotellerie.
Bereits 6-mal verlängert
Die gegenwärtig bis Ende 2027 befristete Geltungsdauer des Sondersatzes von 3,8 Prozent bei der Mehrwertsteuer für Beherbergungsleistungen soll um 8 weitere Jahre bis Ende 2035 verlängert werden, hiess es in einer neuen Vernehmlassungsvorlage, welche vom Parlament kommt.
Der Sondersatz für Beherbergungsleistungen wurde am 1. Oktober 1996 als vorübergehende Massnahme eingeführt, um die Beherbergungsbranche in ihrer damaligen schwierigen Lage zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
Seither wurde die Geltungsdauer des Sondersatzes aber bereits 6-mal verlängert, zuletzt von 2017 bis 2027.
Diese Verlängerung wurde insbesondere mit der starken Aufwertung des Schweizerfrankens begründet.
Dauerprovisorium eingerichtet
Seit Jahrzehnten profitieren Schweizer Hotels also von einem Spezialtarif, der deutlich unter dem Normalsatz von 8,1 Prozent liegt.
Ursprünglich als temporäre Entlastung gedacht, um den Fremdenverkehr der Schweiz mit vielen ausländischen Gästen zu stützen, wurde die Vergünstigung aber immer wieder verlängert.
Die Argumente sind dabei immer gleich: Beherbergungsleistungen würden in erheblichem Ausmass von Personen ohne Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz konsumiert.
Daher habe die Branche Exportcharakter und müsse, wie Exporte auch, von der Mehrwertsteuer befreit werden.
Exporte werden im Ausland verzollt
Doch diese Abgabe ist eine Konsumsteuer und somit hinkt die Argumentation der Hoteliers.
Beherbergungsleistungen werden im Gegensatz zu Exporten jedoch im Inland konsumiert.
Bei Beherbergungsleistungen findet zudem keine Besteuerung im Ausland statt, weil die Leistung im Inland verbraucht wird.
Das ist ein grosser Unterschied. Schweizer Exporte werden mit einer Konsumsteuer belegt – einfach nur nicht in der Schweiz.
Darüber scheinen die Herbergen grosszügig hinwegzusehen.
Dänemark bei 25 Prozent
Auch der Vergleich mit anderen Ländern hinkt, denn der Schweizer Normalsatz von aktuell 8,1 Prozent wäre immer noch tiefer als die reduzierten Steuersätze in den meisten europäischen Staaten.
Von Wettbewerbsverzerrung kann da auch keine Rede sein. Die Schweiz liegt deutlich unter dem von der EU gesetzlich geforderten Mindestsatz von 5 Prozent.
Und in Dänemark sowie Grossbritannien entsprechen die Mehrwertsteuersätze sogar dem Regelsatz von 25 Prozent beziehungsweise 20 Prozent. Von Tourismuskrisen ist dort allerdings nichts zu hören.
«Der Sondersatz führt somit nicht zu einer Gleichstellung von Beherbergungsleistungen mit Exporten, sondern zu einer steuerlichen Privilegierung einer Branche», steht daher auch klipp und klar im erläuternden Bericht zur günstigeren Mehrwertsteuer.
Handling viel zu kompliziert
Der reduzierte Mehrwertsteuersatz kostet die öffentliche Hand jedes Jahr Millionen an Steuereinnahmen.
Der Bund schätzt die Mindereinnahmen auf rund 300 Millionen Franken pro Jahr, die in Zeiten klammer Staatskassen bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV fehlen.
Für eine Aufhebung des Sondersatzes würde zudem sprechen, dass es die Abwicklung der Mehrwertsteuer vereinfachen würde, da bei Beherbergungsbetrieben dann nur noch maximal zwei Steuersätze zur Anwendung kämen.
Ohnehin gibt es schon regelmässig Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Steuersätze mit Hotelpaketen.
Bundesrat tritt auf die Bremse
Viele Schweizer Hotels haben sich an den Komfort der staatlichen Entlastung gewöhnt – und kalkulieren ihn längst als festen Bestandteil ihres Geschäftsmodells ein.
Die Branche hatte sogar mit der Motion von der St.Galler SVP-Ständerätin Esther Friedli auf eine unbefristete Regelung gehofft, um langfristig planen zu können.
Der Bundesrat versucht mit der Limitierung auf 8 Jahre zumindest einen kleinen Riegel vorzuschieben und der Hotelbranche wieder einmal zu signalisieren, sich mittelfristig ohne Extrawürste selbst zu tragen.
Verschiebung der Kundengruppen
Das Hauptargument, die Übernachtungsleistungen hauptsächlich bei Ausländern zu erbringen, stimmt ohnehin nicht mehr.
1996 waren laut dem Bundesrat rund 66 Prozent der Gäste aus dem Ausland angereist.
Nach neuesten Zahlen kommen gerade noch die Hälfte der Hotelgäste aus dem Ausland. Mit der Parahotellerie wären es sogar nur noch 45 Prozent an Ausländer als Hotelkundschaft in der Schweiz.
Es stellt sich deshalb die Frage, ob eine Massnahme, die primär auf die Preissensibilität der ausländischen Gäste abzielt, heute noch zielführend sei, hiess es von der Landesregierung, zumal der Inlandtourismus mittlerweile eine gewichtige Säule der Branche darstelle.
Von Rekord zu Rekord
Die Hotellerie hat auch nicht mal mit einem Nachfrageeinbruch zu kämpfen.
Im vergangenen Jahr zählte die Schweiz rund 43 Millionen Logiernächte, was einen neuen Rekord markierte.
Dies entspricht einer Zunahme von rund 38 Prozent gegenüber 1996, als der Sondersatz eingeführt wurde, und sogar einem Plus von 8,1 Prozent gegenüber 2019, dem Jahr vor der Coronavirus-Pandemie.
Durchfüttern vom Staat
Ökonomisch betrachtet besteht die Gefahr einer Subventionsfalle. Wer sich dauerhaft auf staatliche Entlastung stützt, entwickelt weniger Anreiz für Innovation und Effizienzsteigerung.
Im schlimmsten Fall werden Geschäftsmodelle künstlich am Leben erhalten, die im freien Markt nicht bestehen könnten.
Die Extrawurst für Schweizer Hotels gehört bei all den Gegenargumenten nicht befristet, sondern glasklar abgeschafft.
14.08.2025/kut.