
Die Abschaffung des Eigenmietwerts stellt das Volk vor einen schwierigen Entscheid. Nicht nur Wohneigentum, sondern auch Investments sind betroffen.
Im Zentrum der politischen Diskussion im Vorfeld der Volksabstimmung vom 28. September 2025 stehen die steuerlichen Folgen für das Wohneigentum.
Betroffen sind aber auch Renditeliegenschaften im Privatvermögen, wie die Immobilienwirtschaft in einer neuen Analyse vorrechnet.
Wirtschaftsprüfer rechnen vor
In Abhängigkeit der Finanzierungssituation, der Unterhaltsmassnahmen und der kantonalen Steuergesetzgebung könne sich aus dem Systemwechsel ein steuerlicher Vor- oder Nachteil ergeben, warnte unlängst der Verband der Immobilienwirtschaft Svit.
Grundlage für die Äusserungen ist ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO im Auftrag des Svit Schweiz, welche die einzelfallabhängigen Auswirkungen und die Gestaltungsmöglichkeiten zeigt.
«Fiktive» Einkommen abschaffen
Ende 2024 hatte das Parlament auf Basis einer Motion des ehemaligen SVP-Nationalrats und einstigen Präsidenten des Hauseigentümerverbandes Schweiz Hans Egloff bekanntermassen den Systemwechsel der Wohneigentumsbesteuerung mit der Aufhebung des Eigenmietwerts als fiktives Einkommen bei gleichzeitiger Aufhebung der meisten Abzugsmöglichkeiten beschlossen.
Gleichzeitig soll den Kantonen die Kompetenz eingeräumt werden, eine Liegenschaftssteuer auf Zeitliegenschaften einzuführen. Darüber muss das Volk am 28. September 2025 befinden.
Nach dem bisherigen Recht haben sämtliche Kantone den Mietwert einer selbst genutzten Liegenschaft als steuerbares Naturaleinkommen erfasst.
Der Systemwechsel zielt in erster Linie darauf ab, dieses als «fiktiv» empfundene Einkommen abzuschaffen.
Abzugsmöglichkeiten ändern sich
Doch die Wirkungen sind komplex und auf ein Problem weist die Immobilienwirtschaft zusammen mit der Wirtschaftsprüferanalyse hin.
So müsste ein steuerpflichtiges Ehepaar mit Wohnsitz in Aarau, konfessionslos, deutlich mehr Steuern berappen, wenn es beispielsweise über ein steuerbares Vermögen von 2,0 Millionen Franken, aber kein selbstgenutztes Wohneigentum verfügt.
Die Vergleichsberechnung vor und nach der Reform zeige, dass beim vorliegenden Sachverhalt, der in der Analyse exakt nachvollzogen werden kann, die Steuerlast nach dem Systemwechsel um 7400 Franken höher ausfällt.
Dies sei darauf zurückzuführen, dass Energie- und Umweltschutzsparmassnahmen auf Stufe Bund künftig nicht mehr abzugsfähig seien, und die Schuldzinsen lediglich noch quotenmässig berücksichtigt werden könnten.
Wegfall der Besteuerungsgrundlage
Für dasselbe Ehepaar in Aarau ergäbe sich aber eine geringere Steuerlast von 2700 Franken mit einer leicht geänderten Ausgangssituation.
Die Reduktion der Abgabenlast sei darauf zurückzuführen, dass der Eigenmietwert (abzüglich Liegenschaftsunterhalt) nicht mehr der Besteuerung unterlägen und dieser Vorteil durch den nur noch quotenmässigen Schuldzinsabzug auf der Renditeliegenschaft teilweise kompensiert werde.
Bund kassiert bei Sanierungen
Dei den Aarauer Eheleuten könnte die Steuerlast nach dem Systemwechsel jedoch auch um 3100 Franken höher ausfallen, wie Svit mit einer anderen Konstellation klarmacht.
Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Energie- und Umweltschutzsparmassnahmen auf Stufe Bund nicht mehr abzugsfähig seien und die Schuldzinsen lediglich noch quotenmässig berücksichtigt werden könnten.
Nach dem Systemwechsel entfallen Vorträge auf das Folgejahr beim Bund ganz und auf Kantonsebene zur Hälfte.
Schwierige Abwägung
Die Reform in der Besteuerung von Wohneigentum führt zu grundlegenden Änderungen bei der Besteuerung von selbstgenutztem Wohneigentum.
Bei Renditeliegenschaften wirkt sich die Reform zur Hauptsache bei der Schuldzinsverlegung aus und auf Stufe Bund bei Investitionen in Energie- und Umweltschutzmassnahmen.
Was die Stimmbürger dabei höher gewichten, dürfte nicht so einfach zu entscheiden sein. Einfluss hat eben auch, was wem mehr nützt.
04.07.2025/kut.
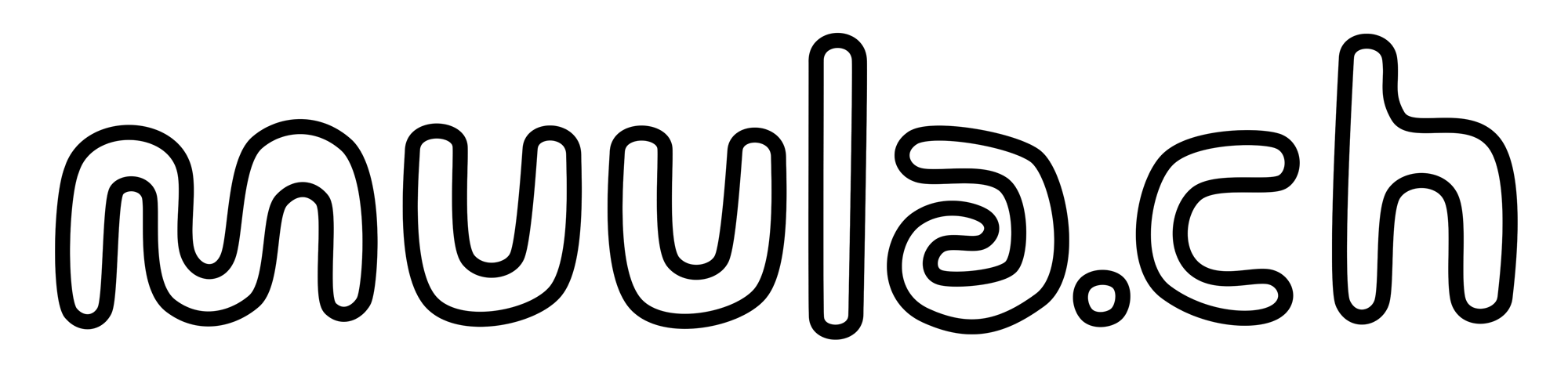
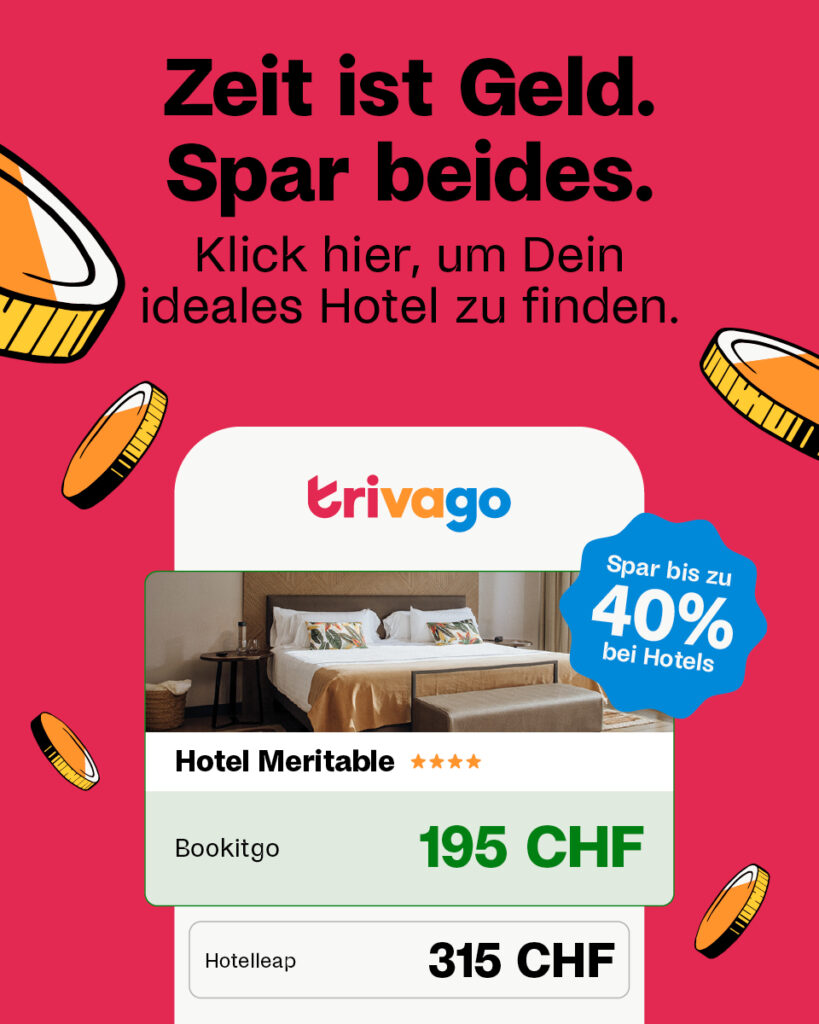



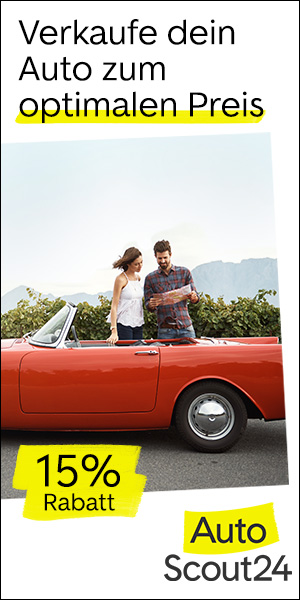
Die Abschaffung des Eigenmietwerts bringt zunächst steuerliche Vorteile für schuldenfreie Eigentümer und Pensionierte. Doch sie reißt ein Loch von 4 bis 5 Milliarden Franken in die Staatsfinanzen. Dieses Geld muss ersetzt werden, zum Beispiel durch neue Steuern wie eine Objektsteuer, die für viele höher ausfallen könnte als der heutige Eigenmietwert.
Zudem fallen wichtige Steuerabzüge für Unterhalt und energetische Sanierungen weg. Dadurch sinkt der Anreiz, Immobilien zu renovieren oder ökologisch zu verbessern. Das schadet der Bauwirtschaft, dem Klimaschutz und dem Zustand der Häuser.
Junge Eigentümer, die ihr Haus mit Hypotheken finanzieren, verlieren den Schuldzinsabzug und zahlen oft mehr Steuern als heute.
Diese Reform bringt wenigen kurzfristig Vorteile, führt aber langfristig zu neuen Steuern, weniger Investitionen in den Wohnraum und höheren Kosten für viele Eigentümer und möglicherweise auch für Mieter.